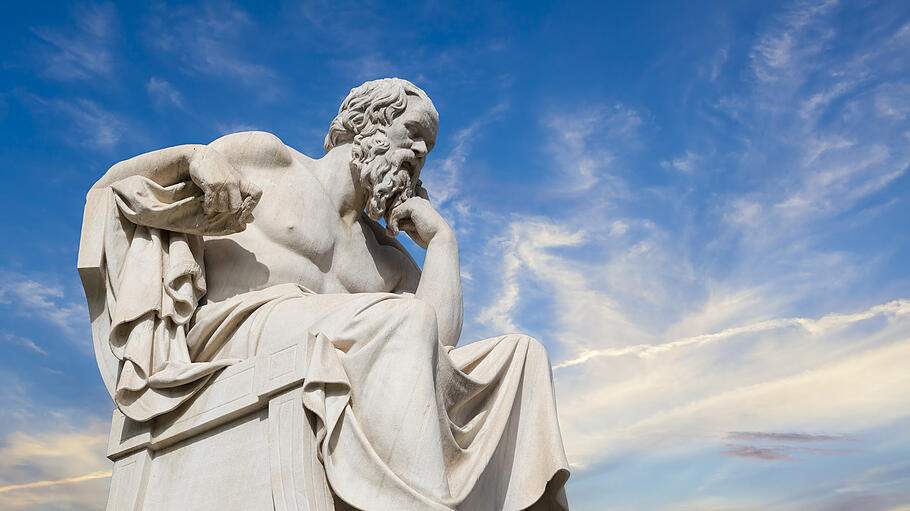Erscheint das abendländische Erbe zumal angesichts des zunehmenden Pluralismus der Religionen, der Integration außereuropäischer Zuwanderer und angesichts einer aggressiven neuen Rechten, die das Abendland beschwört, nur als unnötiger Ballast? Liegt es nicht nahe, dass sich Kirche als nützliche Kraft für Staat und Gesellschaft dadurch erweisen könnte, dass sie auf den Wahrheitsanspruch verzichtet und das abendländische Erbe zur Disposition stellt?
Wahr schließt falsch aus
Der Wettstreit der Ideen ist immer ausgrenzend – Anmerkungen zum Begriff des christlichen Abendlandes. Von Michael Karger