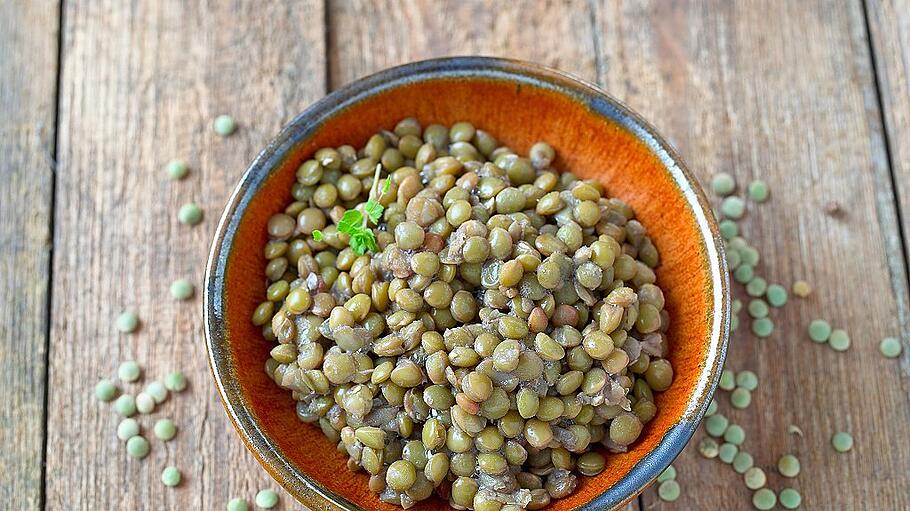Das Abendland hat einen schweren Stand. Spätestens als eine Dresdener Demonstration den Begriff nach einigen Jahrzehnten des politischen Schlafes wieder aufgeweckt hatte, sahen die Artilleristen der großen Medienhäuser die Zeit gekommen, diesen in Artikeln oder Radiofeatures unter Dauerfeuer zu bombardieren. Ob „Focus“, „Süddeutsche“, „Spiegel“ oder „Zeit“: kaum ein Medium, dass nach den ersten PEGIDA-Demos nichts anderes zu tun hatte, als ein Wort zu diffamieren, aus dem einfachen Grund, dass es das falsche Lager benutzte.
Verkauf des kulturellen Erbes
Abendland bedeutet Bekenntnis; darin ist es dem Katholizismus nicht unähnlich. Von Marco Gallina