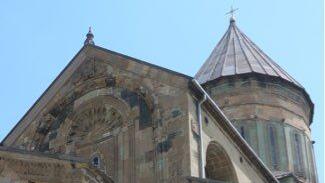Ein Tempel im antiken Stil überwölbt das Häuschen, in dem Stalin 1878 als Sohn eines Flickschusters zur Welt kam. Georgische Brautpaare machen hier gerne ihre Selfies. Daneben steht der Eisenbahnwaggon, den Stalin für die Fahrt zu den Konferenzen in Jalta und Teheran benutzte. Keine russische Reisegruppe lässt sich den Besuch in Gori entgehen. Im Schatten der Bäume bieten Straßenhändler den Touristen allerlei Diktatorenkitsch an: Büsten aus Gips, Anstecker, handkolorierte Fotos. Auf den Mann, der Sowjetnostalgikern das Imperium am Höhepunkt der Macht verkörpert, sind viele Georgier, unter ihnen auch Antikommunisten, immer noch stolz, ungeachtet der zahllosen Verbrechen, die er gerade auch an ihrem Volk begehen ließ.
Unter dem Schutz der heiligen Nino
Konfrontation ohne Feindschaft: Wie Georgien immer mehr unter den Einfluss der russischen Machtsphäre kam.