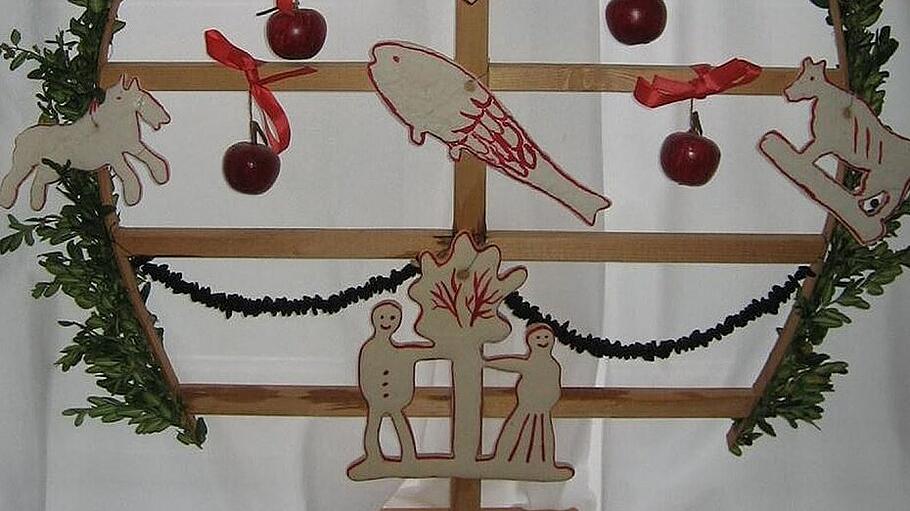Weihnachtsanthologien gehören zum adventlichen Buchangebot. Diese Zusammenstellungen aus Liedern, Gedichten und Kurzgeschichten werden gerne noch mit Plätzchenrezepten angereichert. Zunehmend müssen die Anthologien allerdings mit kleinen monographischen Bändchen wie Weihnachten mit Goethe, mit Storm, mit Rilke oder mit Fallada konkurrieren. Eine auffallend festliche Gestalt hat die Andere Bibliothek ihrer neuen Anthologie gegeben. Ihr Titel: „Das Weihnachtsbuch“ ist selbstbewusst. Kann der Inhalt dieses Versprechen einlösen oder ist es bloßes Marketing? „Es ist unzutreffend, wenn der Verfasser behauptet, dass ‚der heidnische Brauch der Sol-Feier fast unbemerkt in einem christlichen Fest auf- und unterging‘“ ...
Literarische Klassiker zum Fest neu serviert
„Das Weihnachtsbuch“ bietet die großen Erzählungen, scheitert aber an der Auslegung des Weihnachtsgeschehens.