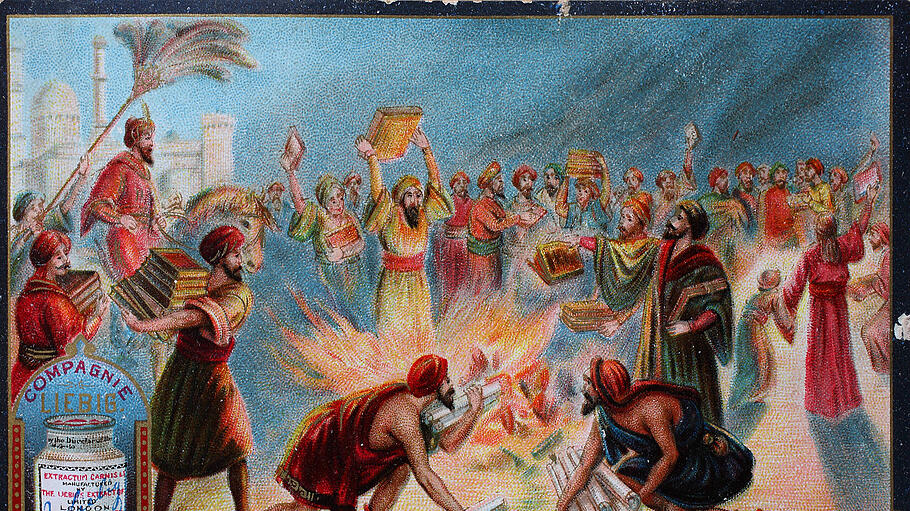Ein Buch zu schreiben über die Entstehungsgeschichte des Buches ist ein waghalsiges Unterfangen – allzu leicht könnte eine staubtrockene Angelegenheit daraus werden. Ist die Ausgangsposition jedoch eine unbändige Leseleidenschaft, gepaart mit Liebe zur Antike und Interesse an den Menschen aller Kulturen wie bei der spanischen Autorin Irene Vallejo, so kann die Gratwanderung gelingen.
Irene Vallejo: Über die Macht der Worte
Die Philologin Irene Vallejo hat mit „Papyrus“ eine spannende Geschichte des Buchs und der Lesekultur geschrieben.