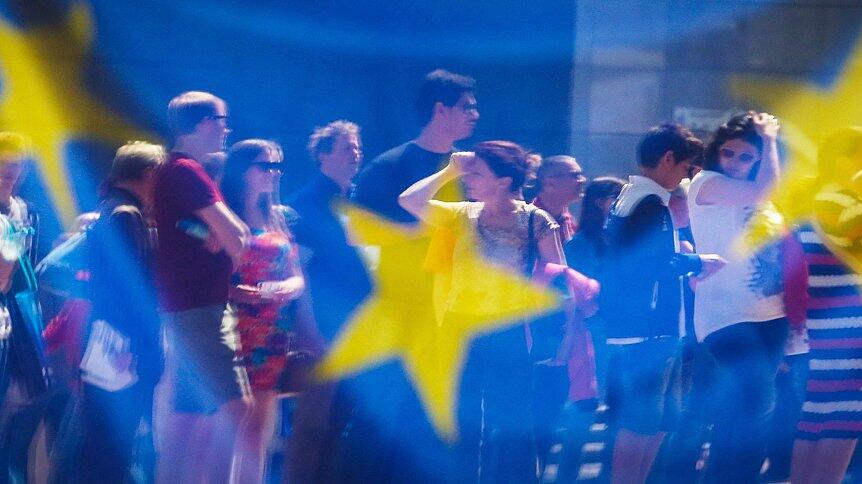Über die politische Zukunft Europas wird seit wenigen Jahren wieder gestritten wie schon lange nicht mehr. Während die ersten Staaten aus dem Unionsverband ausbrechen (Vereinigtes Königreich) oder deutlich auf Distanz gehen (etwa Ungarn, Polen), scheint sich die Politik der EU-Kommission auf ein „Weiter so!“ zu beschränken. Der Wahlkampf für das Europäische Parlament wurde 2019 stark emotional und im Modus der Krise geführt. In dieser gespannten Lage ist jeder Diskussionsbeitrag erwünscht, der neue Perspektiven bietet, ohne in Illusionen abzugleiten.
Impulse für Europas Zukunft
Naturrecht und Tugenden stärken: Der Historiker David Engels plädiert für einen Neubau Europas. Von Daniel Fabian