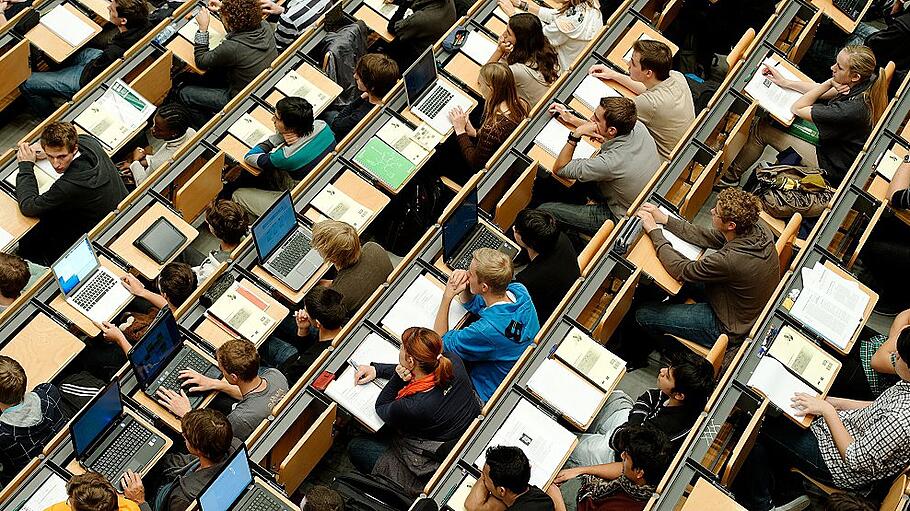Herr Professor Kempen, der Hochschulverband hat eine Erklärung herausgegeben, in der er vor den Folgen der Political Correctness für die Wissenschaft warnt. Was war der Anlass? Schon seit längerem lässt sich feststellen: Die Toleranz gegenüber anderen Meinungen sinkt. Das hat auch Auswirkungen auf die Debattenkultur an Universitäten. Deswegen haben wir erneut auf unserem letzten Verbandstag Anfang April nahezu einstimmig eine Resolution zur Verteidigung der freien Debattenkultur beschlossen. Wir haben auch nur positive Rückmeldungen bekommen, aus allen politischen Richtungen. Der aktuelle Fall der Ethnologin Susanne Schröter, die eine wissenschaftliche Konferenz über das Kopftuch im Islam an der Frankfurter Universität durchführt und ...
Grundrechte in Gefahr
Hochschulverbands-Präsident Bernhard Kempen warnt vor einem Klima an den Universitäten, das die Wissenschaftsfreiheit gefährdet. Der Fall der Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter ist für ihn das Beispiel für einen allgemeinen Trend. Von Sebastian Sasse