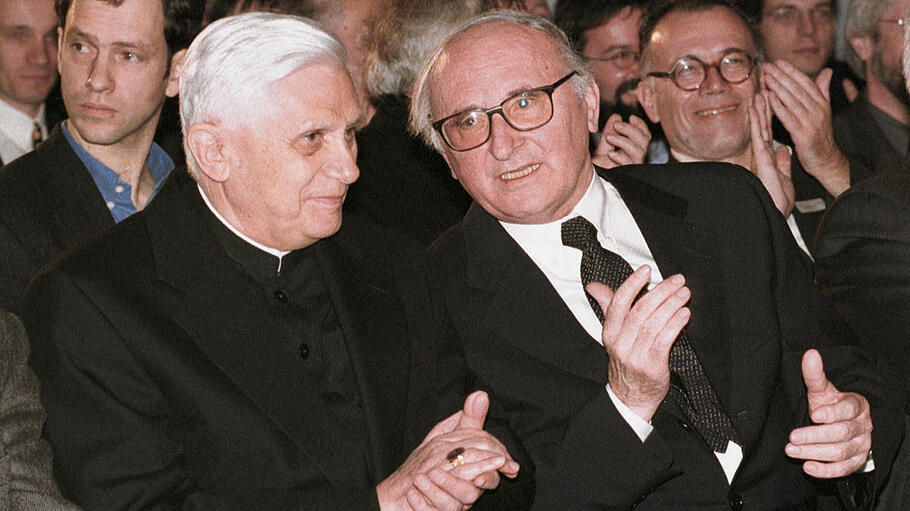Mit Blick auf innerkirchliche Richtungsstreitigkeiten in der Folge des II. Vatikanischen Konzils argumentierte der Philosoph Dietrich von Hildebrand in seinem Buch „Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes“ (1967), es sei im Grunde unsachgemäß und irreführend, von Auseinandersetzungen zwischen einem „konservativen“ und einem „progressiven“ Flügel innerhalb der Kirche zu sprechen: Ob jemand eher konservativ oder eher progressiv gesonnen sei, ob er also eher am Althergebrachten und Gewohnten hänge oder sich eher für Neues begeistere, sei zunächst eine Frage des Temperaments, daher sei prinzipiell weder das eine noch das andere zu tadeln; fragwürdig sei es hingegen, aus solchen Vorlieben eine Ideologie ...
Glaubenskompass 2020
Von wegen rückwärtsgewandt und erstarrt: Kommt die wahre Erneuerung der Kirche von den Konservativen?