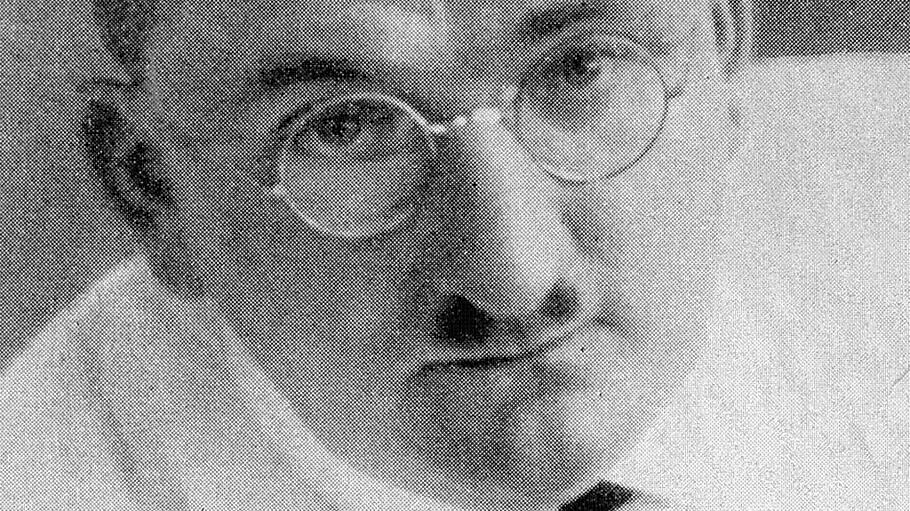Man kann sie sich nicht dramatisch genug vorstellen – die Festnahme des katholischen Journalisten Fritz Gerlich am 9. März 1933 in den Redaktionsräumen der Zeitung „Der gerade Weg“ in München, wie sie Gerlichs früherer Kollege Erwein Freiherr von Aretin (1887–1952) in seinem unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg verfassten Buch „Fritz Michael Gerlich. Lebensbild des Publizisten und christlichen Widerstandskämpfers“ schildert: Die Hausmeisterin stürmte schreiend die Treppe herauf: „Die Hitler kommen!“ Und tatsächlich: Bald darauf traten 50 bewaffnete SA-Männer herein.
Fritz Gerlich: Mutig und standfest bis zuletzt
Der katholische Journalist, Widerstandskämpfer und Märtyrer Fritz Gerlich soll seliggesprochen werden. Mit der offiziellen Eröffnung des Seligsprechungsprozesses durch Kardinal Reinhard Marx wird noch in diesem Jahr gerechnet. Von Stefan Meetschen