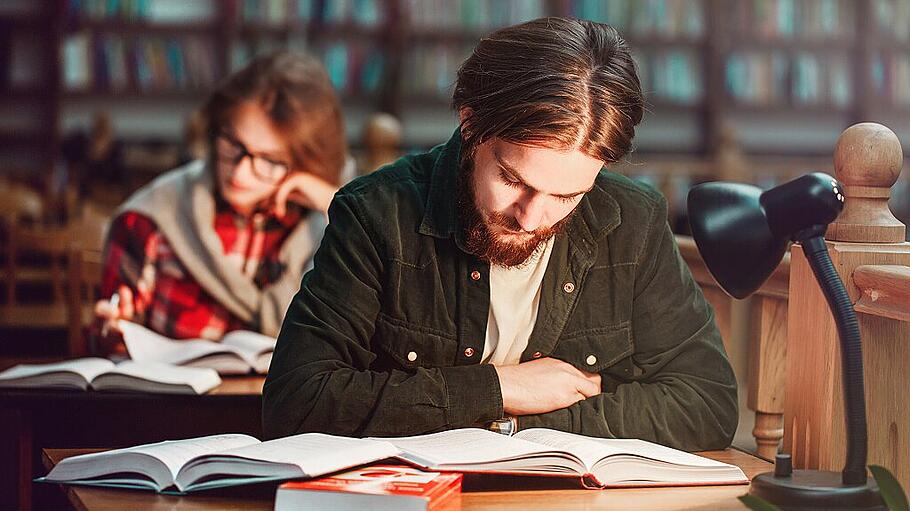Wer in den vergangenen Jahren die Entwicklung der akademischen Welt, vor allem im angelsächsischen Raum, verfolgt hat, kann kaum übersehen, in welchem Maße hier eine Ideologisierung von Forschung und Lehre eingetreten ist, die noch vor 20 Jahren als absurd gegolten hätte. Was seit Jahrzehnten, in gewissen Fächern schon seit Jahrhunderten, als klassischer Lehrstoff betrachtet wurde, ist nunmehr als misogynes und rassistisches Gedankengut „alter weißer Männer“ verschrien und beiseite gewischt worden, während im Gegenzug drittrangige Autoren und anachronistische Forschungsfragen in den Vordergrund gestellt worden sind, die zwar nur wenig Erkenntnisgewinn aufweisen und noch weniger Relevanz dabei haben, das abendländische ...
Forschung und Lehre sind zunehmend absurd ideologisiert
„Normale“ akademische Arbeit wird an den Universitäten immer schwieriger. Wissenschaft muss Gefühlen weichen, die „Wahrheit“ interessiert kaum noch, der Kanon wird von Minderheiten diktiert.