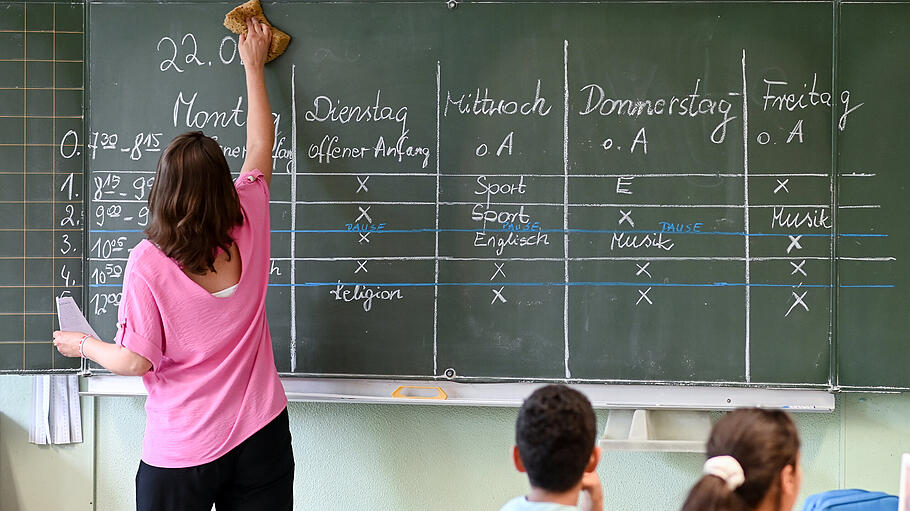Kritik sollte zum Wort des Jahres gekürt werden. Überall, wo man hinschaut, heißt es im intelligenten Milieu: Kritik, Kritik und nochmals Kritik. Ob „Critical Race Theory“ oder „Kritische Theorie“ oder allumfassend „Systemkritik“. Wer heute etwas auf sich hält, schmückt sich mit dem Etikett „Kritik“. Die „Moral“ um „wokeness“ und „political correctness“ muss daher aufpassen. Die „Kritik“ könnte ihr bald den Platz wegräumen. Als leere Worthülse. Denn um eine Corona-Metapher zu nutzen: das kritische Denken befindet sich noch immer im Lockdown.
Deutschland im Krisenmodus
Es gibt viel zu tun, doch Intelligenz oder gar Intellektualität scheint bei Problemlösungen nicht gefragt zu sein.