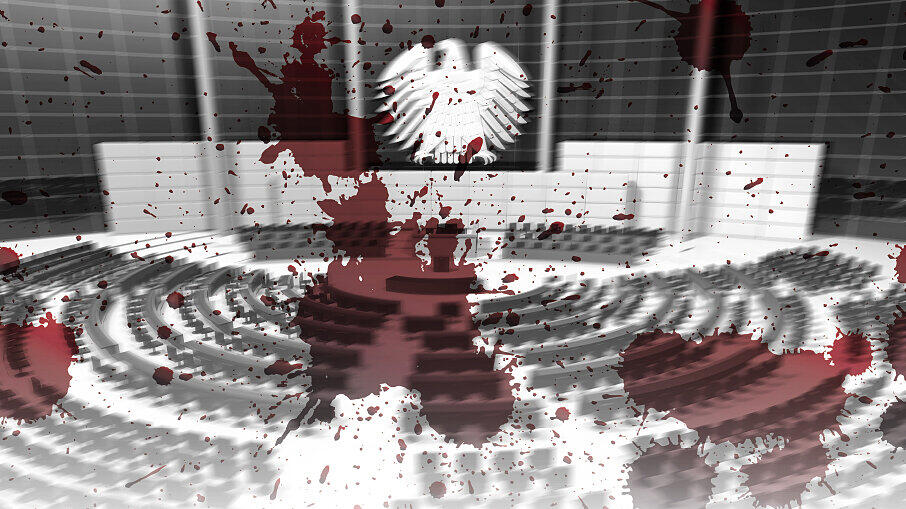In einer weitgehend sachlich und ernsthaft geführten Debatte hat der Deutsche Bundestag am vergangenen Mittwoch ein weiteres Mal über Möglichkeiten einer rechtlichen Neuregelung der Beihilfe zum Suizid diskutiert. In der vergangenen Legislaturperiode hatten die Parlamentarier dazu schon einmal einen Anlauf unternommen. Weil der jedoch nicht rechtzeitig vor der Bundestagswahl zum Abschluss gebracht werden konnte, verfielen alle der damals über die Fraktionsgrenzen hinweg erarbeiteten Gruppenanträge der sogenannten Diskontinuität. Nun hat das Parlament das Gesetzgebungsverfahren erneut gestartet. In der 90-minütigen Orientierungsdebatte warben unterschiedliche Gruppen um Unterstützung für ihre jeweiligen Regelungsmodelle.
Eine weitere Quadratur des Kreises
Mit seinem Urteil vom 26. Februar 2020 hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts den Gesetzgeber vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Bei der Orientierungsdebatte im Parlament zeichneten sich vergangenen Mittwoch drei mögliche Lösungsmodelle ab. Klar ist schon jetzt: Die Quadratur des Kreises wird keinem gelingen.