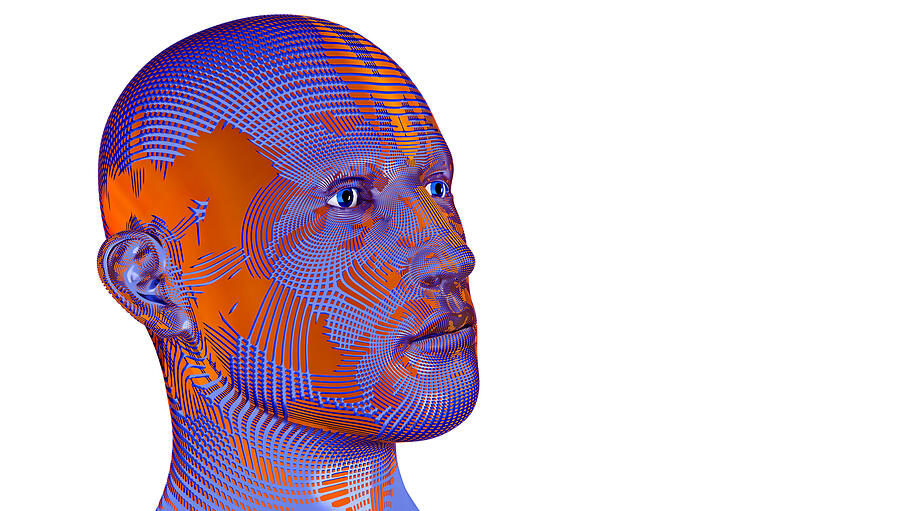Was ist das Fremde? Eine andere, nur oder vielleicht sogar mögliche Form des Eigenen? Wir haben uns daran gewöhnt, das Fremde als etwas Exterritoriales zu betrachten, als eine Form des Raumes, den wir uns noch nicht angeeignet haben. Das Fremde ist aber nicht dieser Raum selbst, sondern es ist das ankommende Fremde, es sind die Menschen, die aus diesem Raum zu uns gelangen. Das Fremde ist der oder die Fremde bei uns, nicht bei sich, denn dort erzeugt der Welttourismus die Illusion, überall zuhause sein zu können und Fremde als Freunde zu betrachten.
Ein fragiles Jetzt entsteht
Was passiert mit dem Menschen, wenn das Vergangene fremd und die Zukunft zum Eigenen wird?