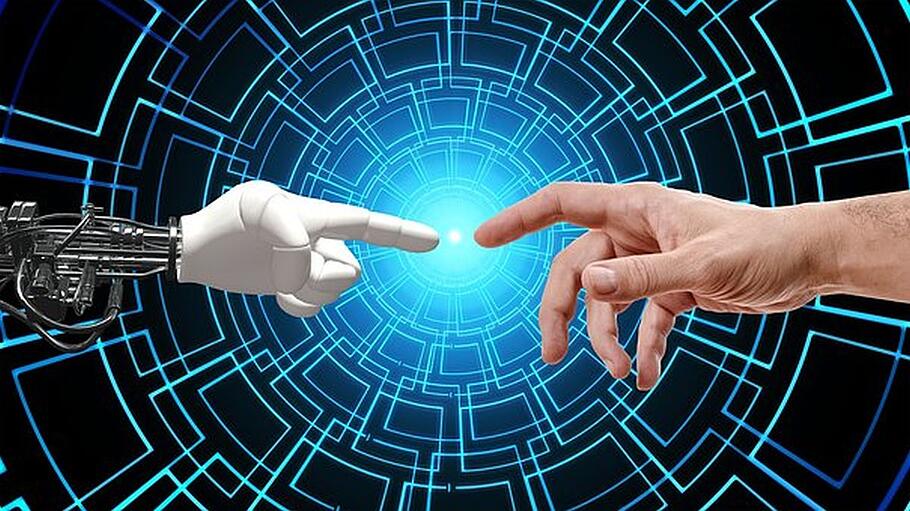Ein Roboter hat Angst vor dem „Tod“. Was klingt wie die Kurzbeschreibung eines kitschigen Science-Fiction-Streifens, läuft derzeit als Sensationsmeldung durch die Wissenschaftsressorts seriöser Zeitungen und wird von einschlägigen Fachportalen aufgegriffen. Sie berichten alle über einen angeblichen „Durchbruch“ in der Künstlichen Intelligenz (KI), so etwa Der Standard (Wien), der schreibt, es gebe eine Kontroverse „um eine KI, die ein eigenes Bewusstsein erlangt haben soll“.
Der Selbstbetrug
Computer rechnen schneller und spielen besser Schach. Auch trifft Künstliche Intelligenz manchmal lukrativere Investitionsentscheidungen. Zwischen Mensch und Maschine klafft dennoch ein unüberwindbarer Graben.