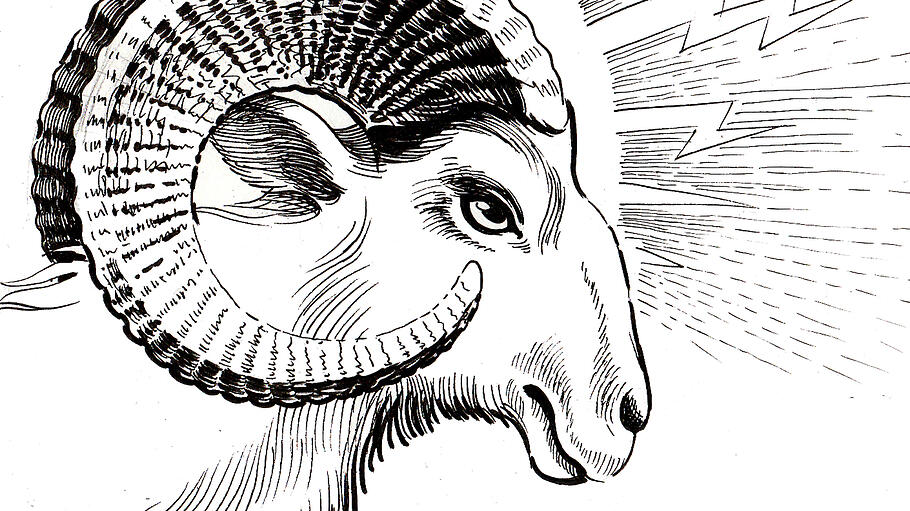Wer „Bocksgesang“ sagt, muss auch „Tragödie“ sagen! So deuteten die Feuilleton-Exegeten im Februar 1993 den rhetorisch scheinbar elitären, mit griechischen Mythen spielenden Titel eines langen Essays namens „Anschwellender Bocksgesang“ des Dramatikers, Erzählers und Essayisten Botho Strauß. Der war zugleich nicht im publizistischen Abseits erschienen, sondern im „Spiegel“, dem Hamburger Wochenmagazin, das zu diesem Zeitpunkt noch gut war für derartige Überraschungen.
Der Seitenwechsel
Vor 25 Jahren forderte der Dichter und Dramatiker Botho Strauß den links- liberalen Kulturbetrieb heraus. Von Ulrich Schacht