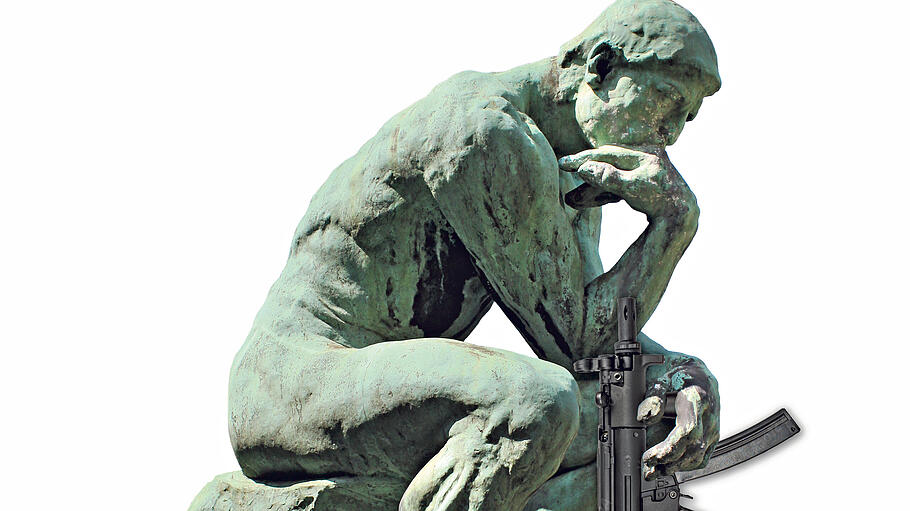Während aufgeregte Zeitgenossen den Kreml-Chef Putin gern mit Hitler vergleichen, hält der einstige US-Außenminister und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger den russischen Despoten eher für eine Figur aus einem Dostojewski-Roman. Tatsächlich lohnt es sich, in diesen irritierenden Zeiten des Ukraine-Kriegs beim überragenden Psychologen der Weltliteratur Visite zu machen. In den politischen Schriften Dostojewskis findet sich ein Aufsatz von 1876 mit dem unscheinbaren Titel: "Einiges über den Krieg". Darin finden sich allerhand Behauptungen, die uns strukturell pazifistisch gesinnte Gegenwarts-Deutsche als Ungeheuerlichkeit anmuten mögen.
Der deutsche Patient will „gut“ sein
Gehört das Aggressionsgehemmte zu unserer Wesensart? Warum verhalten sich so viele Deutsche in Zeiten des Ukraine-Kriegs kriecherisch und verteidigungsuntüchtig? Eine Symptom-Suche mithilfe von Dostojewski.