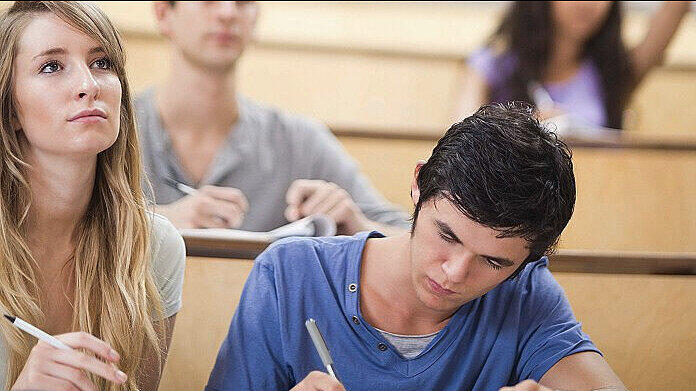Manchmal lässt etwas aufhorchen, was nicht gesagt wurde. Wir nehmen als Beispiel hierfür den im Dezember 2020 verabschiedeten Bundeshaushalt für das Jahr 2021. Danach soll der Etat für Bildung und Forschung von 18, 2 um 2, 6 auf 20,8 Milliarden steigen. Gut so, ist man geneigt zu sagen. Aber es fiel uns eine Redepassage der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in ihrer Rede vom 8. Dezember 2020 im Bundestag auf. Im Fokus von Bildung und Wissenschaft sieht sie: die Bewältigung der Corona-Pandemie, die digitale Bildung, die Klimaforschung, die Mitgestaltung von Schlüsseltechnologien, darunter die Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie.
Ein Volk beraubt sich selbst
Die Nation der Dichter und Denker vernachlässigt die Geisteswissenschaften. Das hat Folgen für die Gesellschaft.