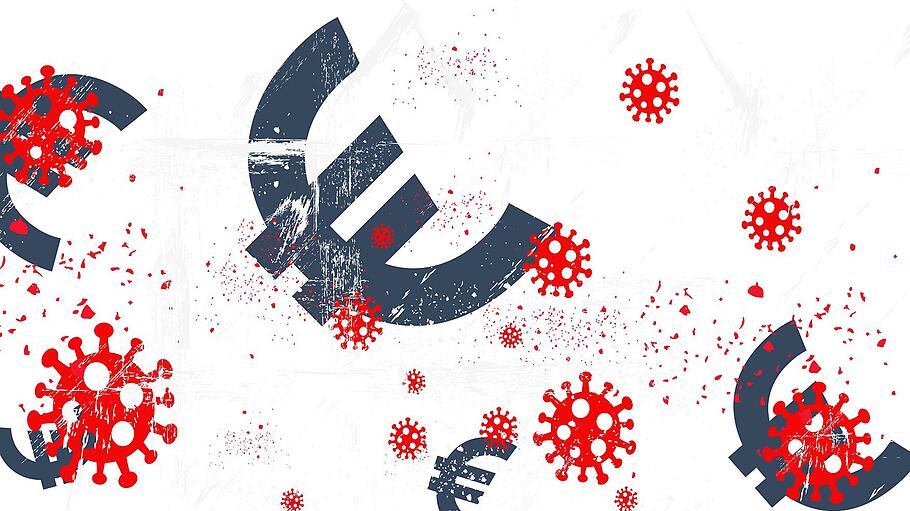Der Lockdown der Wirtschafts- und Arbeitswelt wirkt sich unmittelbar auf das Steueraufkommen des Staates aus. Weil die Kirchensteuer in Deutschland direkt an die Einkommenssteuer gekoppelt ist, wird die Krise direkt die Kirchenfinanzierung betreffen. Denn als Annex-Steuer zur Einkommensteuer, wie das in jüngster Zeit von zahlreichen Bistumssprechern genannt wird, steigt und sinkt sie parallel zur Einkommenssteuer. Damit ist ein wesentlicher Teil der Kirchenfinanzierung einerseits von politischen Entscheidungen und andererseits von der Konjunkturentwicklung abhängig. Beides verlief in der jüngeren Vergangenheit sehr günstig für die Bistümer.
Wie sich die Coronakrise auf die Kirchensteuer auswirkt
Ein Virus dringt in die Kirchen-finanzen ein und macht Bistumshaushalte zu Makulatur.