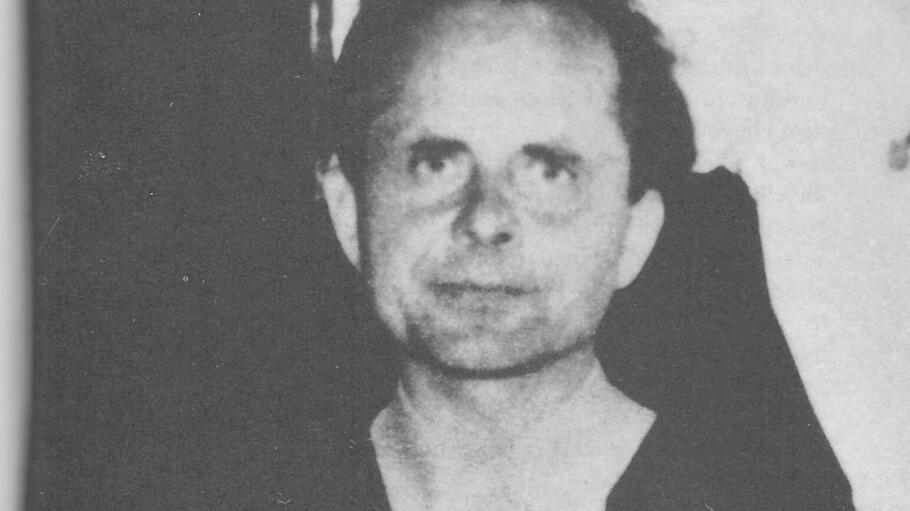Die Kumpanei des deutschen und des sowjetischen Diktators durch den Hitler-Stalin-Pakt, den die Außenminister Ribbentrop und Molotow Ende August 1939 ausgehandelt hatten, ermöglichte Hitler, schon am 1. September 1939 Polen anzugreifen, was Stalin in der zweiten Septemberhälfte dann ebenfalls tat. Durch den geheimen Zusatzvertrag bekam Josef Stalin Estland und Lettland, und in einem zweiten Zusatzvertrag auch Litauen. Außerdem Bessarabien und den Norden der Bukowina.
Stalins Kurswechsel in der Religionspolitik
Warum der Zweite Weltkrieg für die orthodoxe Kirche Entspannung brachte, die Verfolgung der Katholiken in der Sowjetunion aber stärker wurde. Zweiter Teil einer dreiwöchigen Serie über die Situation der Katholiken in der Sowjetunion.