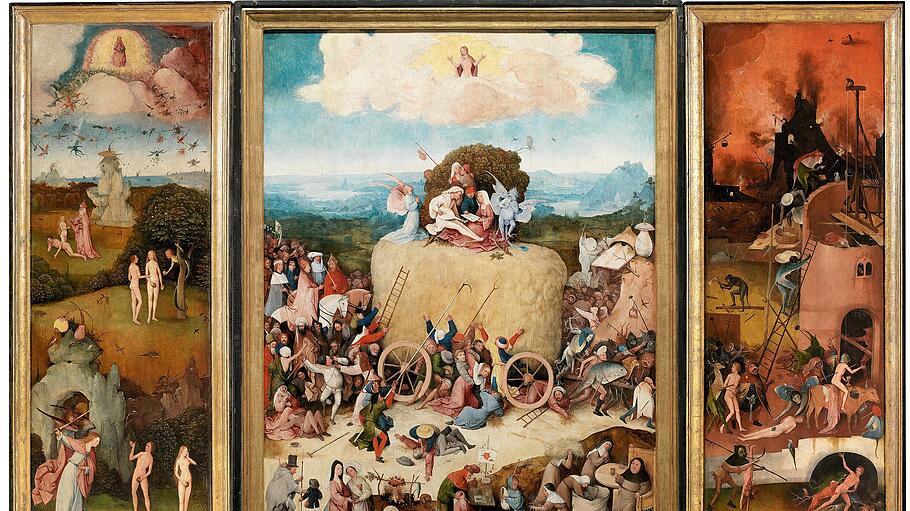Naturkatastrophen, Seuchen und kollektiv wie persönlich erlittenes Schicksal wurde zu allen Zeiten auch religiös und theologisch gedeutet. Die Heilige Schrift erzählt vom Ringen Israels mit seinem Gott angesichts erlittenen Leidens; das Leiden Christi selbst findet nach der Überzeugung der Kirche eine Deutung in den Gottesknechtsliedern oder im Schicksal Hiobs. Das Leiden des Menschen und der Ratschluss Gottes sind in der Überlieferungsgeschichte nicht zu trennen. Aber straft Gott? Und straft er auch durch die Auferlegung zeitlichen Strafen wie Epidemien? Oder durch deren Zulassung?
Ist die Corona-Epidemie die Strafe Gottes?
Die Frage wirkt auf den modernen Menschen provokativ, doch in der christlichen Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte galt der strafende Gott lange als unstrittig. Nun ist die Debatte über die Strafen Gottes neu entflammt.