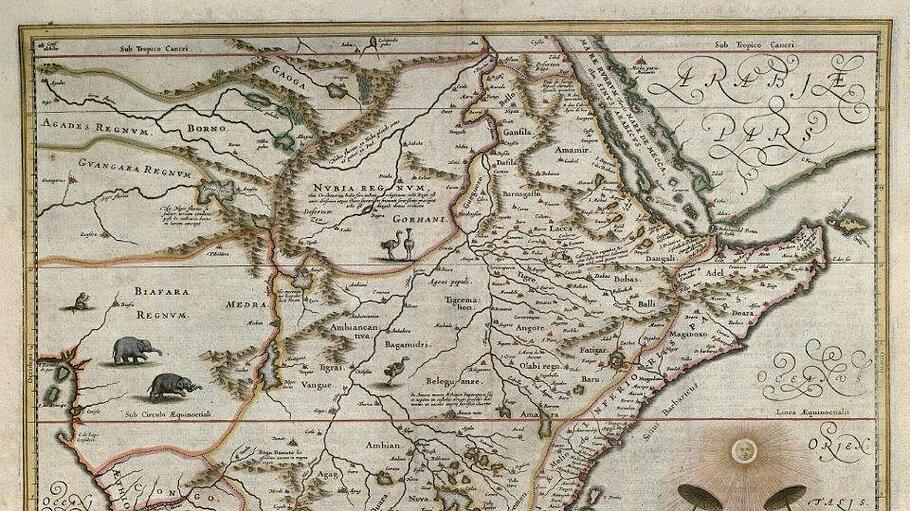Der Baske Ignatius von Loyola gründete 1534 die „Societas Iesu“. Von Anfang an beschäftigten den Ordensgründer missionarische Fragen und – er hatte bereits 1523 eine Pilgerfahrt nach Palästina gemacht – das Christentum des Orients. Besonderes Interesse an Äthiopien entwickelte Ignatius durch seinen Aufenthalt in Rom, als er die formelle Zustimmung von Papst Paul III. zur Gründung des neuen Ordens erhielt. Das Gemälde eines unbekannten Künstlers hält die denkwürdige Szene fest, in welcher Ignatius von Loyola dem Papst die Gründungsurkunde vorlegt.
Intermezzo eines katholischen Äthiopien
Ignatius von Loyola wollte Teile Afrikas missionieren, scheiterte aber nach ersten Erfolgen und musste schließlich sogar fliehen.