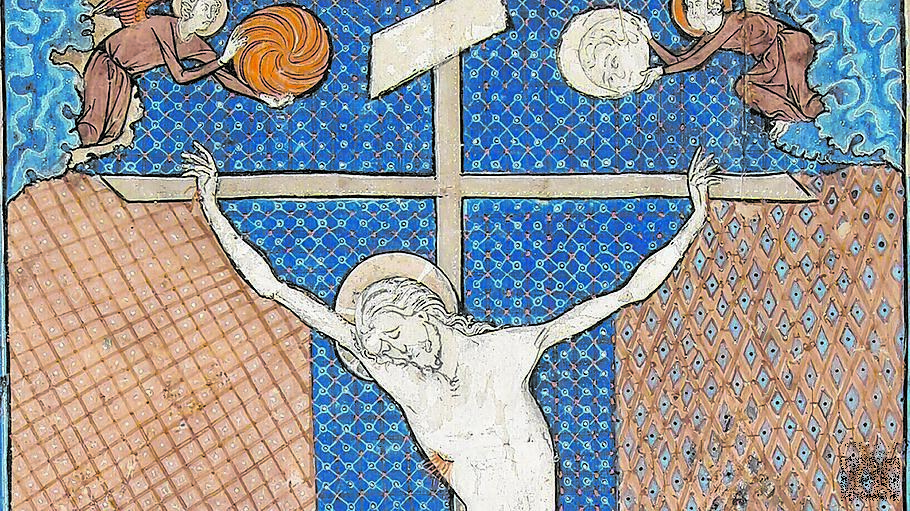In aller Geschichte wohnt, lebt, ist Gott zu erkennen.“ Mehr noch: „Jede Tat zeugt von ihm, jeder Augenblick predigt seinen Namen, am meisten aber, dünkt mich, der Zusammenhang der großen Geschichte.“ Es war Leopold von Ranke (1795–1886), der aus christlichem Glauben heraus Geschichte zu erforschen suchte, dabei an sich selbst und seine Historikerzunft die höchsten Anforderungen stellte und tatsächlich zu einem der Gründerväter der modernen Geschichtswissenschaft avancierte. Zur christlichen Botschaft gehört zentral die Botschaft vom Gott des Lebens und der Geschichte. Der Gott Jesu Christi ist kein ferner Gott, kein – mo-dern gesprochen – „Uhrmacher-Gott“, der zwar einmal, ...
Gottes Masterplan
Wie der Kirchenlehrer Thomas von Aquin die Stellung und Sendung des Menschen sieht.