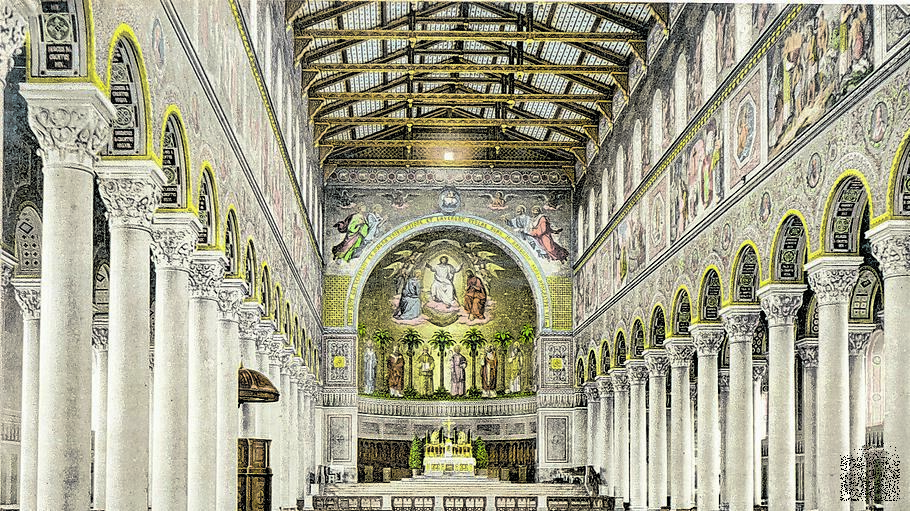Irgendwie mag das doch nicht so recht passen: Ludwig I. gibt wegen einer außerehelichen Affäre mit der Tänzerin Lola Montez nach massivem öffentlichen Druck im Revolutionsjahr 1848 seinen Thron auf, gleichzeitig ist er es aber, der dem noch jungen bayerischen Königreich, das er während seiner 23-jährigen Regierungszeit ab 1825 formt, bewusst einen starken katholischen Stempel aufgedrückt hat.
Der König und die Klöster
Vor 200 Jahren wurde Ludwig I. zum König von Bayern gekrönt. Der Monarch förderte in besonderer Weise die Benediktiner.