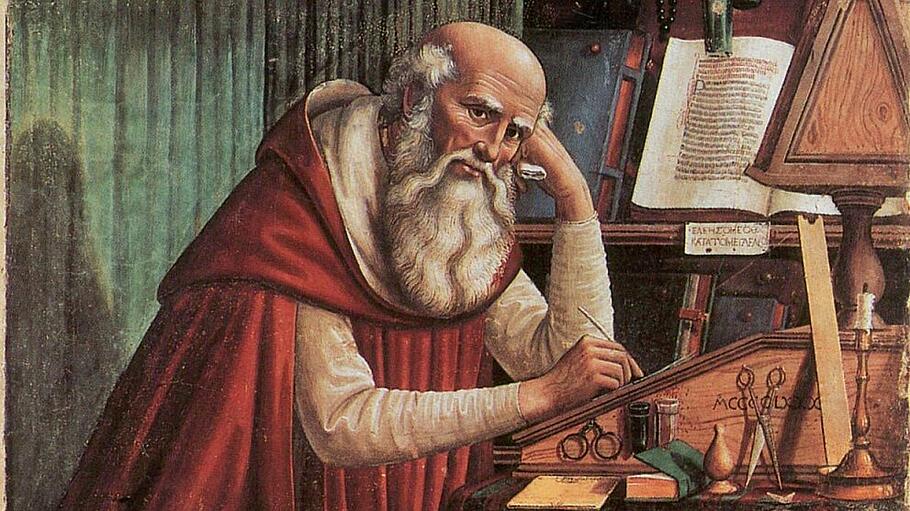Dürfen Christen reich sein? Sind nicht Christus selbst und die Apostel arm gewesen? Gibt es nicht im Neuen Testament das Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr und die Geschichte von dem reichen Jüngling, der traurig wegging, als Jesus ihn aufforderte, seinen Besitz aufzugeben? Solche Fragen bewegten die Gemüter im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder. Eine besondere Virulenz gewannen sie in der Spätantike. Die sogenannte „konstantinische Wende“ veränderte die soziologische Zusammensetzung der christlichen Gemeinden. Nun traten vermehrt auch die „oberen Zehntausend“ in die Kirche ein, die ihre Mitglieder zuvor vor allem aus der Mittel- und der Unterschicht rekrutiert hatte. Der enorme Luxus, in dem diese kleine ...
Zwischen Kreuz und Mammon
Eine historische Untersuchung über die frühen Christen und das Geld. Von Clemens Schlip