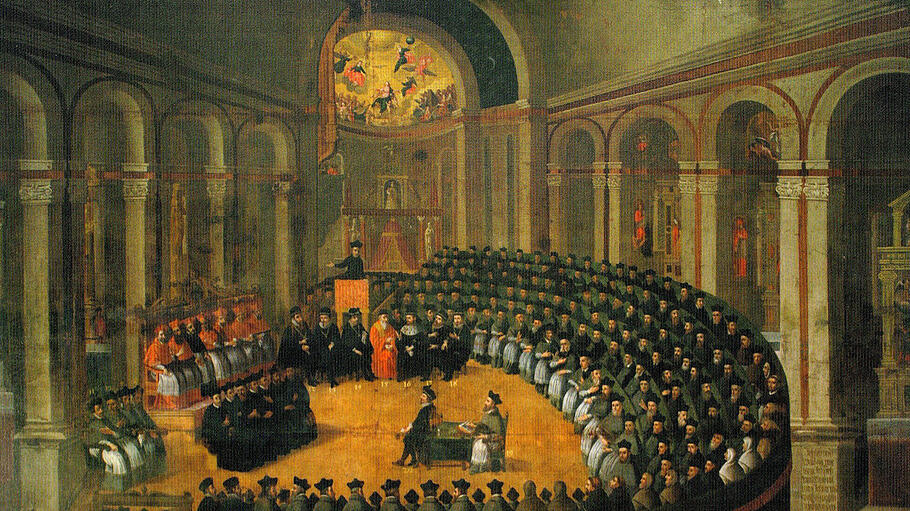Wenngleich die wenigsten Gläubigen von diesem Thema selbst betroffen sind, kommt ihm im Rahmen der anhaltenden, vor allem deutschen Reformdebatten ein großer Stellenwert zu. Gemeint ist die Lebensweise katholischer Priester, die allzu oft auf Begriffe wie Ehelosigkeit und sexuelle Enthaltsamkeit reduziert wird. Dabei stellt der Zölibat in seinem grundlegenden Wesen erheblich mehr dar als nur Verzicht und Bereitschaft zum Opfer.
Über die Entstehung des Pflichtzölibats
Über die Entstehung des Pflichtzölibats im ersten Jahrtausend.