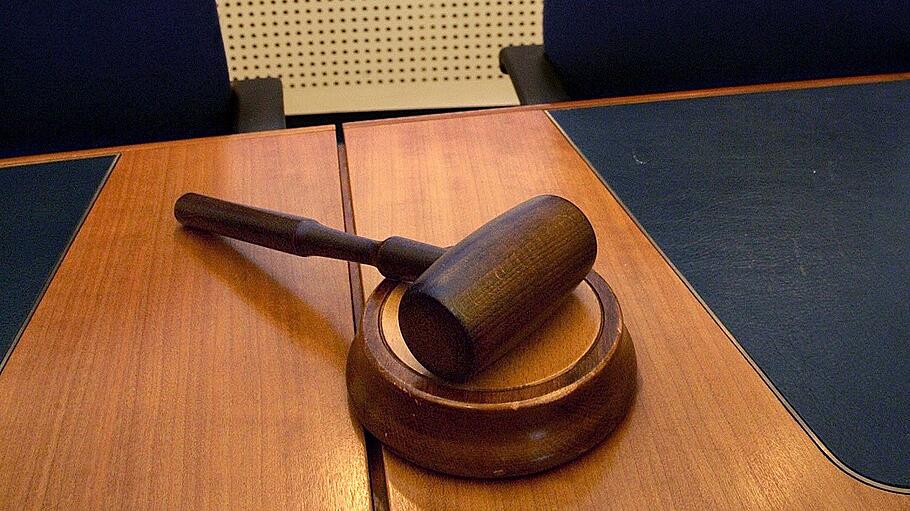Auf Einladung der Joseph-Höffner-Gesellschaft hat Ansgar Hense am Dienstag die Gedächtnisvorlesung im Bonner Uni-Club gehalten. Der Direktor des Instituts für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands sprach zur Etablierung einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit zum Thema „Rechtsschutz in der katholischen Kirche – eine unendliche Geschichte?“ Mit der Neuauflage des Themas kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit griff zur Frühjahrsvollversammlung die Bischofskonferenzen ein Thema auf, das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer wieder angegangen wurde. Hense zitierte darum auch eine Äußerung Hans Mayers, ehemaliger Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken im Deutschlandfunk: „In einem ...
Nicht jammern, sondern klagen?
Die Diskussion um eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit wird in jüngerer Zeit wieder verstärkt geführt. Eine Debatte an der Universität Bonn zeigt, dass es dabei nicht nur um rechtliche Fragen geht.