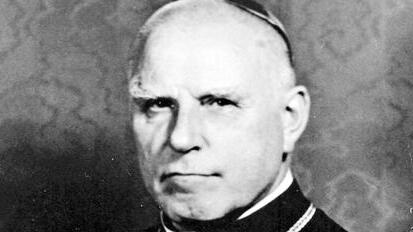Manchmal wird gefragt, welche intellektuellen und geistlichen Hilfen katholische Priester in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts von Bischöfen oder Theologieprofessoren zur Unterscheidung der Geister erhielten und ob es solche Hilfen überhaupt gab. Bis zu einem gewissen Grade ist diese Fragestellung zu modern gedacht und entspricht nicht den zeitgenössischen Umständen. Es gab in den Bistümern noch keine „Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten“, wie es auch noch keine „Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen“ gab.
Hilfen zur Unterscheidung der Geister
Zu den „Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts“. Von Harm Klueting