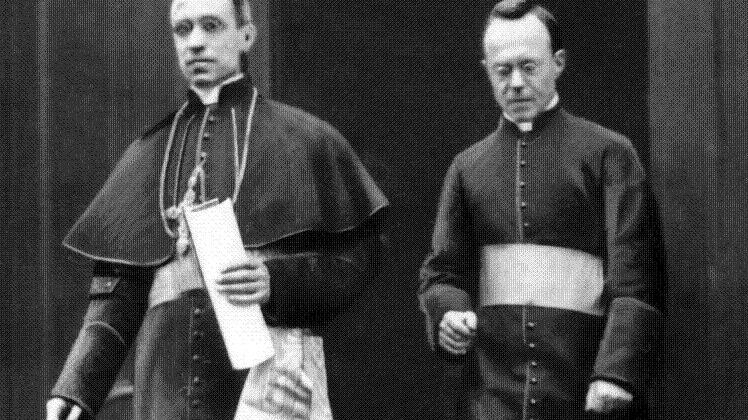Wie reagierte die Kirche, als in Deutschland in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hunderte Synagogen und Betstuben jüdischer Gemeinden brannten, jüdische Geschäfte geplündert und verwüstet, jüdische Mitbürger schikaniert, geschlagen oder gar ermordet wurden? Zu wenig, sagen die Kritiker. Ein großer, öffentlicher Protest blieb aus. Lediglich ein einziger Priester, Dompropst Bernhard Lichtenberg aus Berlin, prangerte die Pogromnacht in seiner Predigt am nächsten Tag an und betete fortan in der Hedwigskathedrale, keinen Kilometer von Hitlers Reichskanzlei entfernt, für die verfolgten Juden, bis ihn am 23. Oktober 1941 die Gestapo verhaftete.
Evakuierung um jeden Preis
In diesem Monat jährt sich die Reichspogromnacht zum 80. Mal. Nun beweisen Dokumente, der Vatikan plante die Evakuierung deutscher Juden nach der „Kristallnacht“. Von Michael Hesemann