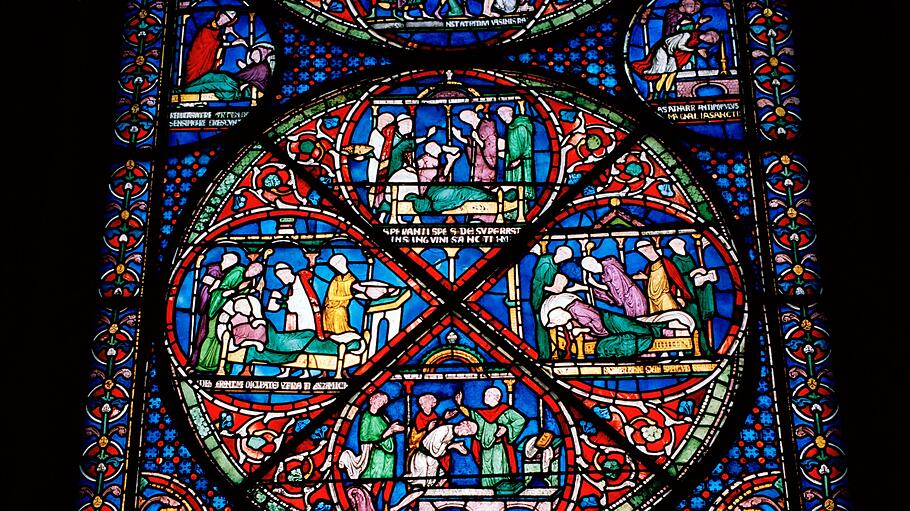Verehrter Herr Erzbischof, Sie wurden in Italien geboren, haben die längste Zeit Ihres Lebens als theologischer Lehrer und Abt in Frankreich verbracht und sind als Erzbischof von Canterbury gestorben. Wie war das möglich in einem Europa ohne die einende Macht moderner Verkehrs- und Kommunikationsmittel? Europa war geeint durch die römische Rechtskultur, den christlichen Glauben, besonders auch durch die Benediktinerklöster und die lateinische Sprache. Gemeinsam mit den an den Sitzen vieler Bischöfe entstehenden Kathedralschulen tradierten die Klosterschulen die große Philosophie der Antike und die Theologie der Väter und schufen ein kulturelles Band, das stärker war als alle politisch bedingten Differenzen. Der Ruf einer jeden ...
„Der Theologe ist kein Archivar“
Der heilige Anselm von Canterbury (1033–1109) wollte die Vernünftigkeit des Glaubens der Kirche erweisen.