In der Kunstformel „Synodaler Prozess“, die bewusst nicht eine Synode im kirchenrechtlichen Sinn beschreiben will, leitet sich das Adjektiv trotzdem vom griechischen Wort „synodos“ (Gemeinsam-auf-dem-Weg-Sein, Zusammenkunft, aber auch: Zusammenstoß) ab. Die Versammlung zur Klärung strittiger Fragen, die auf eine Übereinstimmung zielt, produziert – wie die Kirchengeschichte beweist – immer wieder auch Konflikte und Verletzungen. Oft beginnen die Auseinandersetzungen mit Debatten über den Inhalt und die Gewichtung von Aussagen der Heiligen Schrift, von Festlegungen der Überlieferungsgeschichte und von Entscheidungen des kirchlichen Lehramts.
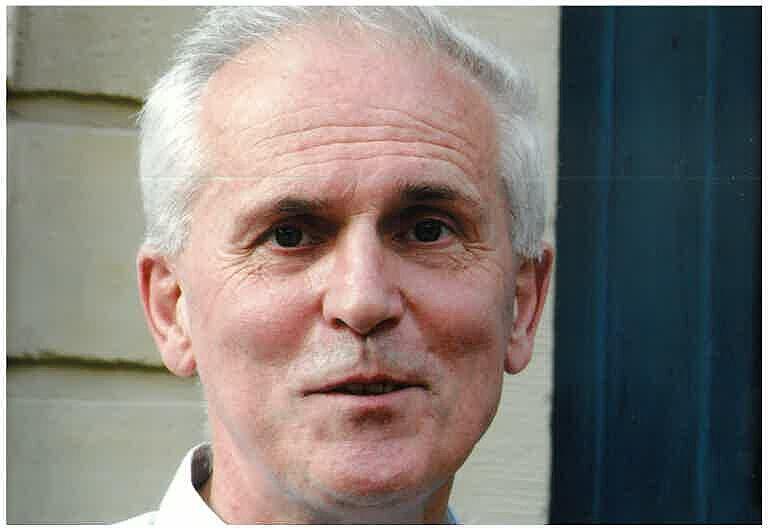
In der ökumenischen Diskussion gehören die Heilige Schrift, die Tradition (als Überlieferung des Glaubensinhalts), das (kirchliche) Lehramt, die Theologie und das Zeugnis (der Glaubenssinn) des ganzen Volkes Gottes diachron (durch die Jahrhunderte hindurch) und synchron (gegenwärtig und weltweit) zu den fünf Bezeugungsinstanzen der Offenbarung „als Selbstmitteilung Gottes in der Geschichte, die ihren Höhepunkt und ihre Vollendung in Jesus Christus hat“ (Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, 2003).
Gottes Wort ist kein Buch, sondern Christus
Allerdings stehen diese verschiedenen Bezeugungs- und Erkenntnisinstanzen nicht gleichrangig nebeneinander, sondern sind ihrerseits gestuft. Die grundlegende Instanz ist die Bibel, die norma normans (die alles andere normierende Norm) des Glaubens, die jedoch nach christlichem Verständnis nur in einem analogen Sinn als Wort Gottes gelten kann, denn das eigentliche Wort Gottes ist im Sinne des Prologs des Johannesevangeliums (Johannes 1,1-14) und der Offenbarungskonstitution „Dei Verbum“ (= Wort Gottes) des Zweiten Vatikanums der Gottmensch Jesus Christus. Die Aussage des Koran, die Christen seien (wie die Juden) Leute des „Buches“, ist deshalb irreführend.
Eine herausragende Stellung unter allen Schriften des Neuen Testaments nehmen die vier Evangelien ein, da sie die Person, das Leben und die Lehre Jesu Christi beschreiben. Die grundsätzliche Historizität der Evangelienberichte über Jesus wird nach den Übertreibungen der Aufklärung und der ersten Phase der Leben-Jesu-Forschung vom Zweiten Vatikanum „ohne Bedenken bejaht“ („Dei verbum“ 19,1). Es ist auch plausibel, dass die Evangelisten tatsächlich der Überzeugung waren, dass sich Jesus Christus selbst seinen Jüngern wenigstens implizit als der Sohn Gottes geoffenbart habe und dass dieser Anspruch durch die Auferstehung bekräftigt worden sei. Alle anderen Hypothesen für die Übertragung des Sohn-Gottes-Titels auf Jesus schaffen mehr Probleme als sie lösen.
Zwei „Fehlwege“ der Tradition in der Kirchengeschichte
Die Offenbarung ist nach kirchlicher Lehre abgeschlossen „mit dem Tod des letzten Apostels“. Es ist auch keine weitere öffentliche Offenbarung mehr zu erwarten („Dei verbum“ 4,2). Karl Rahner wollte diese Zeitbestimmung mit dem Abschluss der Kanonbildung des Neuen Testaments im vierten Jahrhundert gleichsetzen und behauptete, dass sich die Kirche in dieser konstitutiven Zeit in freier geschichtlicher Entscheidung, die aber vom Heiligen Geist sanktioniert worden ist (vgl. Apostelgeschichte 15,28), eine verbindliche Lehre (in der Gestalt des neutestamentlichen Kanons) und eine ebenso verbindliche Struktur (in der Form einer monarchisch-episkopalen Verfassung und eines bleibenden Petrusamtes) gegeben habe. Die apostolische Tradition (im Unterschied zu menschlichen Traditionen in der Kirche, die nicht allgemein verpflichtend sind) ist die Weitergabe der zuerst von den Aposteln bezeugten Botschaft über Jesus Christus in der Kirche. In Johannes 16,13–15 erwähnt Jesus den „Geist der Wahrheit“, der die Jünger „in die ganze Wahrheit“ führen werde, indem er von der Botschaft Jesu „nehmen“ werde. Es geht also um eine Vermittlung zwischen der bleibenden Ursprungsoffenbarung in Jesus Christus und dem Wirken des Geistes in der Geschichte.
Joseph Ratzinger und Walter Kasper haben deshalb von zwei „Fehlwegen“ der Tradition in der Kirchengeschichte gesprochen. Die Position des „Archäologismus“ (beispielhaft vertreten im „theologischen Klassizismus“ eines Johann Josef Ignaz von Döllinger) erklärt, eine frühere oder auch die früheste Gestalt des Glaubens oder der Kirche sei die heute einzig maßgebliche.
Unmittelbarer Zugang zum Heiligen Geist?
Im Hintergrund steht ein Verfallsschema, demzufolge das zeitlich Frühere deswegen das sachlich Ursprünglichere sei. Für Ratzinger stellt der „Archäologismus“ den Versuch dar, „die Tradition an irgendeinem Punkt abschließen“ zu wollen, weil er die bleibende Gegenwart des Geistes Christi in der Kirche nicht ernst nehme.
Die Auffassung des „Enthusiasmus“, den Luther bei den von ihm so bezeichneten „Schwärmern“ kritisiert, besagt, die heutigen Christen hätten in Verantwortung gegenüber den gegenwärtigen Menschen einen unmittelbaren Zugang zu Gott oder zum Heiligen Geist, aufgrund dessen sie das Christentum besser verstehen als frühere Generationen oder gar als Jesus und die Jünger. Er bedient sich eines Evolutions- beziehungsweise Entwicklungsschemas, das die Glaubens- und Dogmengeschichte als organische Fortentwicklung aus einem anfänglichen Keim und das jetzt kirchlich-dogmatisch Existierende als den augenblicklich erreichbaren Höchstzustand des Christentums interpretiert.
Reform: Maßnehmen an Jesus Christus
Damit ignoriert er die bleibende Ursprungsbezogenheit der Kirche, die einerseits stets auch Traditionskritik fordert, andererseits aber zugleich ein Reformpotenzial (als nochmaliges Maßnehmen an der Ursprungsform Jesus Christus in der Bedeutung des lateinischen Wortes „re-formare“) eröffnet.
Die notwendige Vermittlung beider Extreme geschah in der Kirchengeschichte normalerweise auf Synoden. Der Kirchenhistoriker Klaus Schatz hat in seiner Geschichte des Ersten Vatikanums darauf hingewiesen, dass Konzilien gewöhnlich versucht haben, Entscheidungen im Konsens zu erzielen (bis hin zum Preis des Verzichts auf Beschlussfassungen). Wo offensichtlich Minderheiten majorisiert worden seien (wie in Ephesus, Konstantinopel II, auf dem Ersten Vatikanum), hätten sich aus solchen Entscheidungen in der Regel Spaltungen ergeben. Die Rücksicht auf die „Schwachen“ (die für Paulus immer die anderen Mitchristen sind) um der Einheit willen, ist für den Römerbrief (Kap. 14) geradezu ein Erkennungszeichen der Kirche.
Intellektuelles Nachdenken über den Glauben
Als die christlichen Apologeten bei griechischen und römischen Philosophen (allerdings nicht in den antiken Religionen) „Samenkörner“ des göttlichen Logos entdeckten und das Christentum als „wahre Philosophie“ und Aufklärung über die Religionen darstellten, fanden sie bei Platon die Forderung an die Vernunft, Maßstäbe und Regeln aufzustellen, um das Gott-Künden der antiken Dichter und Geschichtenerzähler kritisch zu läutern, und bei Aristoteles die Idee einer philosophischen Theologie im Sinne einer Suche nach Gott mit der menschlichen Vernunft.
Im dritten Jahrhundert beginnt dann (vielleicht mit Origenes) ein intellektuelles Nachdenken über den Glauben, das zunächst vornehmlich von Bischöfen (neben und in ihrem Amt der Glaubensverkündigung) betrieben wurde. Mit der Gründung der Universitäten im Hochmittelalter entsteht der Gedanke einer akademischen Theologie (verstanden als Glaubenswissenschaft im Sinne der Wissenschaftsidee des Aristoteles), deren Motto Anselm von Canterbury in der Klosterschule von Bec vorgibt: „fides quaerens intellectum“ („Glaube, der nach Einsicht sucht“). Thomas von Aquin unterscheidet deshalb ein doppeltes Lehramt, das Lehramt der Hirten beziehungsweise Bischöfe (magisterium cathedrae pastoralis) mit den Aufgaben der Leitung in der Glaubensverkündigung und des Aufbaus (beziehungsweise der Bewahrung der Einheit) der Kirche und das Lehramt der Professoren (magisterium cathedrae magistralis) mit den Aufgaben der Forschung und der wissenschaftlichen Lehre.
Verschiedene Ämter, andere Aufgaben
Die Jahrhunderte nach Thomas sahen dann immer wieder Versuche der beiden so unterschiedenen Ämter, jeweils die andere Aufgabe gleich mitzuübernehmen. Zum einen etablierte sich die theologische Fakultät der Sorbonne im Mittelalter als Gerichtsinstanz (in den Verurteilungen des Avignon-Papstes Johannes XXII. 1331, des Templerordens oder von Jeanne d'Arc) und konzipierte im 19. Jahrhundert Döllinger die Theologie (analog zum alttestamentlichen Prophetentum) als die letztlich entscheidende Instanz der Glaubensdarstellung, die mittels der öffentlichen Meinung in der Kirche auch die Bischöfe unter ihre Autorität beuge. Zum anderen haben römische Theologen und Kirchenführer zumal im 20. Jahrhundert das Modell entwickelt, dass es nur ein einziges kirchliches Lehramt (der Bischöfe) gebe, dem die Theologie zuzuarbeiten habe. Für eine Unterscheidung verschiedener Ämter in der Kirche und für den gegenseitigen Respekt vor dieser Funktionsverteilung hat schon Paulus geworben (1. Korintherbrief 12,28f): „So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer… Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer?“
Im 19. Jahrhundert hat John Henry Newman davor gewarnt, die Aufgaben der Bischöfe (und des Papstes) und der Theologen miteinander zu vermischen. Nur so könne zum Beispiel die Theologie ihren spezifischen Dienst in der Kirche – in der freien Diskussion wissenschaftlicher Hypothesen, die wiederum durch die Vielgestalt der verschiedenen theologischen Schulen garantiert sei – auch angesichts ihrer möglichen Gefährdungen – in der eventuellen Überschätzung der Fähigkeiten der menschlichen Vernunft – gerade im Verhältnis etwa zur Volksfrömmigkeit und zum bischöflichen Amt ausüben.
Kurz gefasst:
Die Heilige Schrift, die Tradition (als Überlieferung des Glaubensinhalts), das (kirchliche) Lehramt, die Theologie und das Zeugnis (der Glaubenssinn) des ganzen Volkes Gottes diachron (durch die Jahrhunderte hindurch) und synchron (gegenwärtig und weltweit) gehören zu den fünf Bezeugungsinstanzen der Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes in der Geschichte. Diese verschiedenen Bezeugungs- und Erkenntnisinstanzen stehen nicht gleichrangig nebeneinander, sondern sind ihrerseits gestuft. Die grundlegende Instanz ist die Bibel. Eine herausragende Stellung unter allen Schriften des Neuen Testaments nehmen die vier Evangelien ein, da sie die Person, das Leben und die Lehre Jesu Christi beschreiben. Nach kirchlicher Lehre ist die Offenbarung „mit dem Tod des letzten Apostels“ abgeschlossen. Die apostolische Tradition ist die Weitergabe der zuerst von den Aposteln bezeugten Botschaft über Jesus Christus in der Kirche.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen. Kostenlos erhalten Sie die aktuelle Ausgabe












