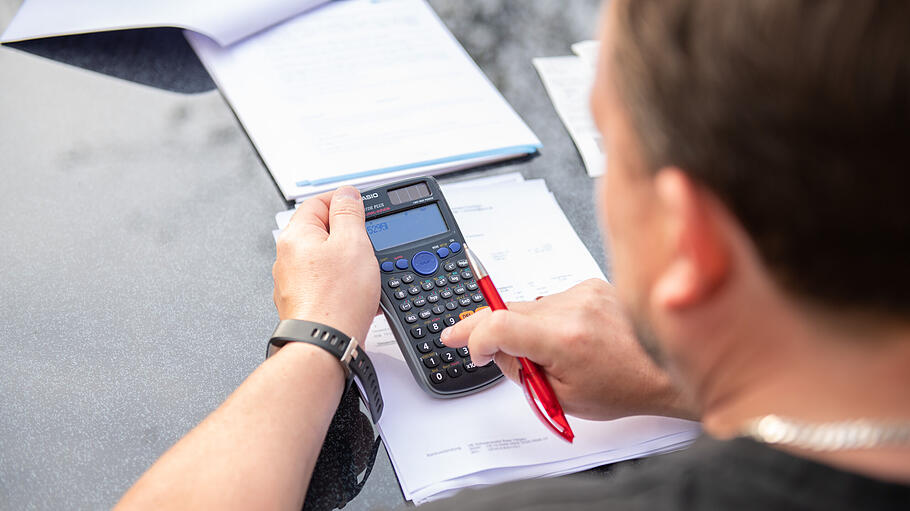Das Leben ist für uns alle spürbar teurer geworden. Der Krieg in der Ukraine und eine Inflation von derzeit 10 Prozent treiben die Verbraucherpreise in die Höhe. Ein Ende der Steigerungen ist nicht in Sicht. Durch Mehrausgaben gelingt es nur noch jedem Zweiten, Geld auf die Seite zu legen und zu sparen. Vor zwei Jahren, während der Corona-Krise, war dies noch gut 70 Prozent der Bevölkerung möglich. Die Menschen blicken mit Sorge auf den beginnenden Winter und den damit einhergehenden Mehrverbrauch an Strom, Gas, Öl und anderem Brennmaterial.
Wohlstand ade?
Für Menschen in prekären Lebensverhältnissen wird sich ihre schwierige Situation noch verschärfen. Hier sind tragfähige Lösungen, insbesondere in der Lohn-, Sozial- und Wirtschaftspolitik nötig.