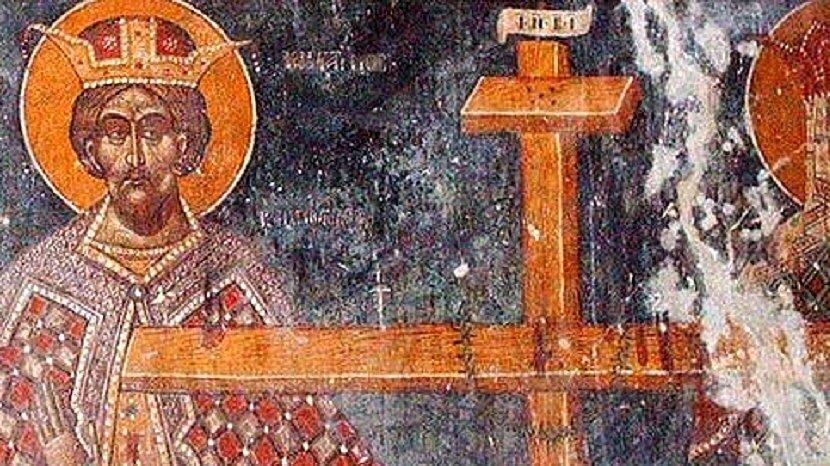Als die Apostel Paulus und Barnabas auf einer ihrer Missionsreisen im kleinasiatischen Lystra ein Heilungswunder wirkten, beeindruckte das die Volksmenge verständlicherweise. Aus heutiger Sicht erstaunlich ist, wie die Menschen reagierten: Sie hielten die beiden Fremden für Götter, den Barnabas für Zeus und den Paulus für Hermes. Die Tatsache des Wunders an sich kritisch zu hinterfragen, kam ihnen offensichtlich nicht in den Sinn. Aufgeschlossenheit für übersinnliche Phänomene konnten die antiken Verkünder des Christentums bei ihren Zeitgenossen in der Regel tatsächlich voraussetzen. Aber woran glaubten die Menschen damals, in der römischen Kaiserzeit, eigentlich genau, sofern sie nicht Christen oder Juden waren?
Sieg der Christen
Christlicher Alltag zur Zeit Jesu. Von Clemens Schlip