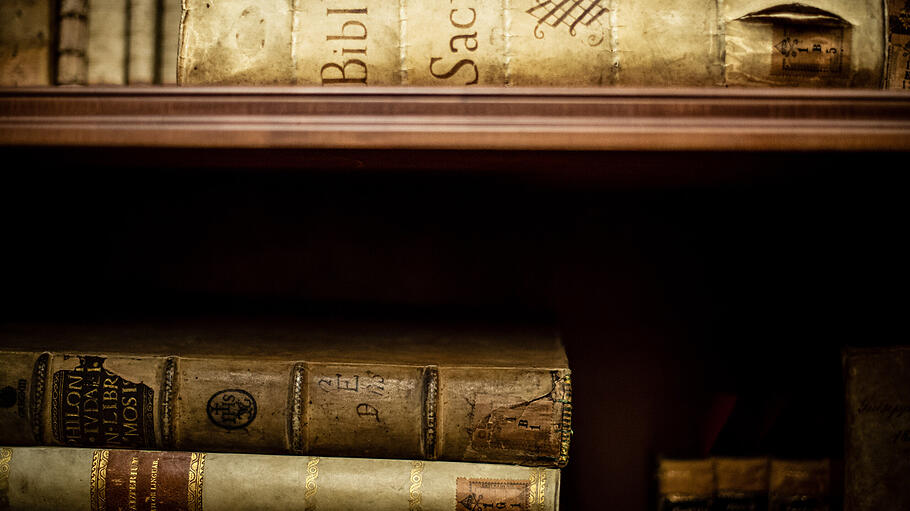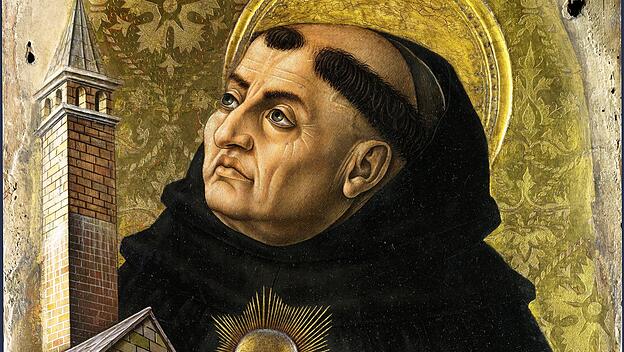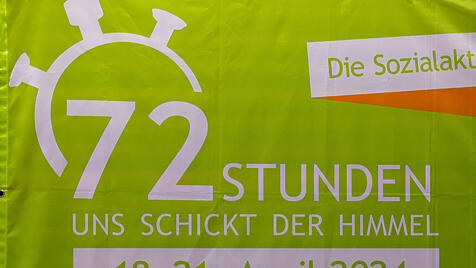Wenn man sich mit Konzilien beschäftigt, ist es immer eine gute Idee, das historische Umfeld mit in den Blick zu nehmen. Denn natürlich sind weder beim Zweiten Vatikanischen noch beim Tridentinischen Konzil, um das es im vorliegenden Buch geht, die Beschlüsse vom Himmel gefallen. Sie sind vielmehr die Frucht vorangehender Problemstellungen und Auseinandersetzungen. Sowohl die Beschlüsse selbst als auch deren Rezeptionsgeschichte sind daher immer kontextuell zu interpretieren.
Deshalb ist das in der von Walter Kardinal Brandmüller herausgegebenen Reihe „Konziliengeschichte“ erschienene Buch von Mathias Mütel mit dem Titel „Mit den Kirchenvätern gegen Martin Luther. Die Debatten um Tradition und auctoriatas patrum auf dem Konzil von Trient“ eine wichtige Hilfe zum Verständnis dessen, was auf dem Konzil besprochen und beschlossen wurde. Im Kern ging es dabei um die Frage, wer die wahre Kirche repräsentiert. Martin Luther hatte dies, sich auf die Heilige Schrift und die als ideal postulierten Verhältnisse in der Urkirche beziehend, für sich reklamiert und nahm auch viele Kirchenväter und einige Heilige als Kronzeugen für seine zur Spaltung der Kirche führenden Reformversuche in Anspruch.
Ob dies gerechtfertigt war, ist eine der Fragen, die die Konzilsväter damals umtrieb. Und deshalb unterzogen sie sich der Mühe einer detaillierten Analyse eben jener Schriften der Tradition, auf die die eine heilige katholische Kirche sich beruft, und stärkten so das Verständnis für den Entwicklungsaspekt des Leibes Christi, der sich an den Schriften der Kirchenväter so detailgenau ablesen lässt und durch deren Autorität gestärkt wird.
Relevanz und Wirkung der auctoritas patrum
Hierzu untersucht Mütel zunächst die Relevanz der auctoritas patrum bei den vortridentinischen Kontroverstheologen John Fisher, Johannes Eck, Johannes Driedo und Albert Pigge. Jeder dieser Theologen wird in einem biografischen Abriss kurz vorgestellt. Dem folgt ein Überblick über das jeweils zugrunde gelegte Werk und eine Analyse der dort vorgestellten Thesen. Das zweite Kapitel widmet sich der Wirkmächtigkeit der auctoritas patrum in den Schriften der spanischen Konzilsteilnehmer und kontextualisiert dies mit der theologischen Erkenntnislehre der Schule von Salamanca und dem Traditionsverständnis von Melchior Canos, Martín Pérez de Ayala und Alfonso Castro.
Das dritte Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über die vorgelegten Florilegien und Traktate, die die Grundlage der Debatten bildeten. So wird der Grund für das Verständnis der Diskussionen vor der vierten Sessio gelegt, die zur Verabschiedung des Dekrets Sacrosancta führte. Das fünfte Kapitel widmet sich schließlich der Funktion der Kirchenväter in Bezug auf die Anliegen der Reformation. Hierbei geht es auch um die Aufarbeitung eigener Defizite im Hinblick auf den Umgang mit der Heiligen Schrift, einen der Kernpunkte, um die es in der Reformation zwar nicht ursprünglich, aber in der Folge der sich durch den Buchdruck ungemein rasch verbreitenden Bibelübersetzung Martin Luthers schließlich ging.
Das Ergebnis von Mütels umfangreichen Analysen ist eindeutig: Die Konzilsväter beabsichtigten weder zu Beginn noch in den Debatten der vierten Sessio, eine abgeschlossene theologische Erkenntnislehre vorzulegen. Ihr Anliegen war vielmehr, die theologische Kontinuität des theologischen Denkens herauszustellen und anhand der Schriften der Kirchenväter zu entfalten.
Tradition und Inspiration
Dabei wurde auch deutlich, dass sowohl die Heilige Schrift als auch die Tradition miteinander verbundene Offenbarungsquellen sind, deren letztere die Schrifttexte durch deren Auslegung insofern verdeutlicht, als sich nicht alle Glaubensinhalte eo ipso aus der Schrift ergeben. Die Heilige Schrift bedarf, so waren die Väter des tridentinischen Konzils überzeugt, der Auslegung durch die Tradition, die das Gesamtverständnis des Glaubens umfasst. Als eine ekklesiologische Wirklichkeit bilden Schrift und Tradition einen Raum, innerhalb dessen der Glaube verinnerlicht und gelebt werden kann. Verkürzungen und Irrwege, wie sie bei einem direkten, nicht durch die Tradition vermittelten und vertieften Zugang immer wieder auftreten, können durch diese Verbindung leichter vermieden werden.
Der Schlüssel für diese Deutung liegt im Begriff der Inspiration, der sich nicht nur auf den Autor der biblischen Texte, sondern auch auf die sie deutenden und auslegenden Kirchenväter bezieht, die alle gemeinsam den Leib Christi bilden. Ein entscheidendes Argument, denn wer so denkt, nimmt die Kirche als Leib Christi als durch die Zeiten hinweg wirkende und wirksame, sprich miteinander vernetzte Wirklichkeit wahr. Auf ihr beruht die gläubige Gewissheit der, wie Mütel es formuliert, „pneumatischen Assistenz, in der die unversehrte Bewahrung des Depositum fidei und die innere Kontinuität der Glaubensentwicklung der Kirche vorausgesetzt wird“.
Genau dieses Begleitetsein durch den Heiligen Geist aber ist mehr als die von Luther postulierte historische Relevanz der von ihm verwendeten Argumente der Kirchenväter. Denn es öffnet die Kirche für den performativen Prozess des in allen Zeiten erforderlichen Bemühens um die Christusförmigkeit der Glieder des Leibes Christi. Mütel hat mit dieser peniblen, detailgenauen Analyse ein wichtiges Instrument vorgelegt, das auch als Verständnishintergrund für die derzeit so engagiert diskutierten Formen der Umsetzung und des Verstehens der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils dienen kann. Denn letztlich geht es dabei um dieselbe sich vor Augen zu haltende Grundwahrheit, die der Autor pointiert so zusammenfasst: „Entscheidend ist dabei die Kirche als Tradentin der ursprünglichen Tradition, die stets dieselbe ist, ohne die Gleiche zu sein, und gerade dadurch mit sich selbst identisch bleibt.“
Mathias Mütel: Konziliengeschichte. Mit den Kirchenvätern gegen Martin Luther. Die Debatten um Tradition und auctoritas patrum auf dem Konzil von Trient.
Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017, 357 Seiten, ISBN 978-3-506-78540-4, EUR 89,-
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen. Kostenlos erhalten Sie die aktuelle Ausgabe