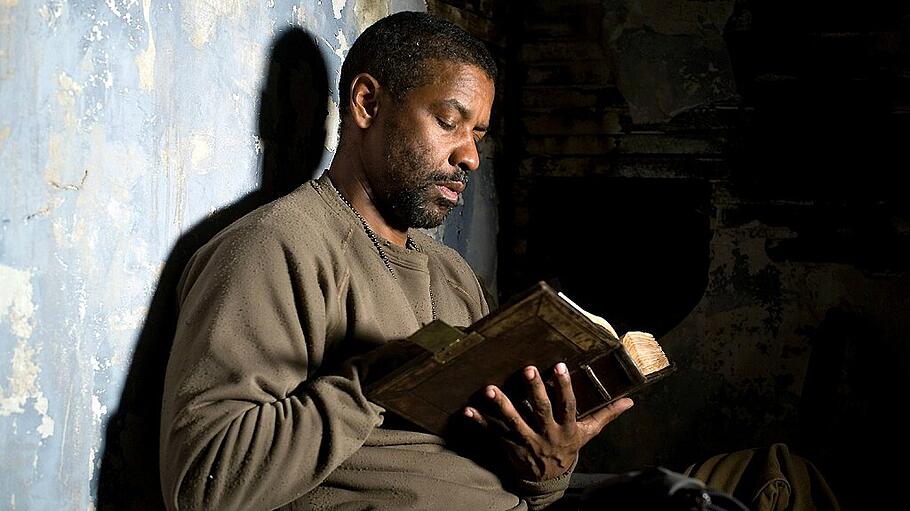Fiktion hilft, die Wirklichkeit besser zu verstehen. Immer wenn Jesus seinen Jüngern eine besondere Lehre erteilen wollte, schilderte er ihnen keine Ereignisse – er erzählte ihnen eine Geschichte, etwa das wunderbare Gleichnis des barmherzigen Vaters, der den verlorenen Sohn mit offenen Armen empfängt. Ein Gleichnis, das der Herr nach einem klassischen Drehbuch in drei Akten – Weggang aus dem Vaterhaus, Umkehr nach dem Verschleudern des Erbes und der Verarmung, Rückkehr und Wiederannahme an Sohnes Statt – beschreibt.
Wird die Welt gerechter?
Wie Zukunftsvisionen in Filmen für die Zeit nach der Corona-Krise Orientierung liefern können.