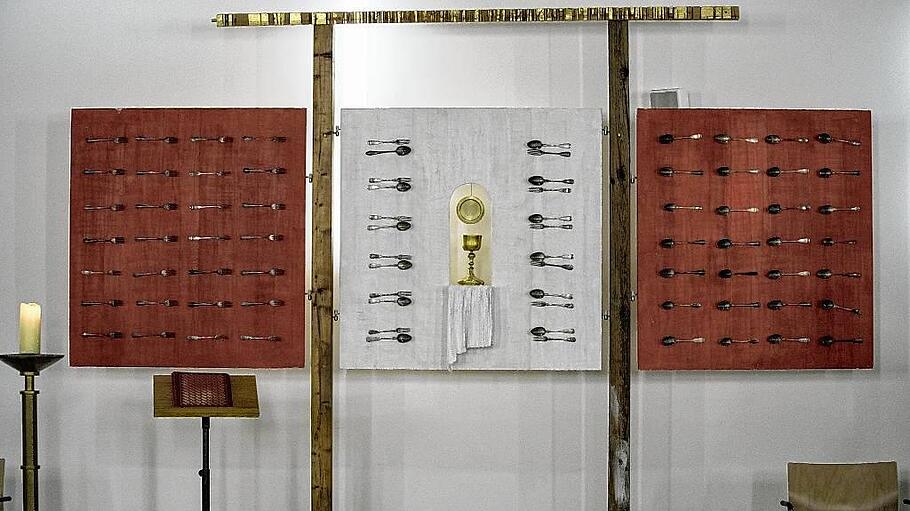Solange Menschen atmen, werden sie Bilder brauchen.“ Unter diesem Motto stand am Sonntagabend eine Podiumsveranstaltung im Burkardushaus des Bistums Würzburg. Zum neunten Mal hatte der Priester und Inhaber des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg, Martin Stuflesser, zu einer Gesprächsrunde zur „Liturgie der Zukunft“ eingeladen. Diesmal ging es um das Verhältnis von Liturgie und Kunst. Die religiöse Bildwelt spielte an diesem Abend eine besondere Rolle, denn der Gottesdienst ist nicht nur von der Kunst geprägt, sondern selbst eine Kunstform, eine „Ars celebrandi“, wie es in der Einladung hieß.
Durch Bilder den Glauben verstehen
In Würzburg eine Podiumsdiskussion mit Bischof Friedhelm Hofmann zu „Liturgie und Kunst“. Von Alexander Riebel