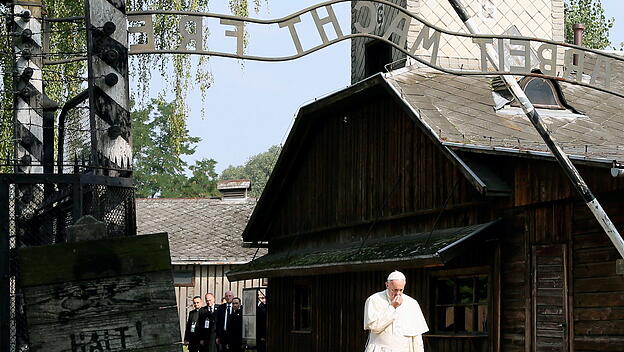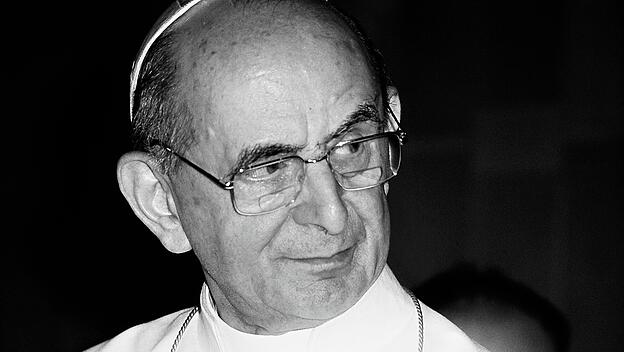Auf der einen Seite zahlreiche Neubauten mit ihren modernen, puristischen Fassaden, gegenüber die Hinterlassenschaften des DDR-Wohnungsbaus, riesige Plattenbauten hintereinander in Reih‘ und Glied, dazwischen eine große Baulücke. Nein, dass wir uns hier auf einer Insel befinden, darauf käme niemand, der es nicht besser wüsste. Das ganze Szenario wird durchschnitten von der vierspurigen Kleinen Gertraudenstraße, deren Geräuschkulisse unablässig daran erinnert, dass wir uns hier direkt in Berlin-Mitte befinden.
Und doch: Wir sind auf einer Insel, der Fischerinsel in der Spree – und wo jetzt die riesige Baulücke klafft, soll auch in gesellschaftlicher Perspektive eine Insel entstehen: Das „House of One“, ein gemeinsamer Sakralbau der drei großen monotheistischen Religionen. Eine evangelische Kirche, eine Synagoge und eine Moschee sollen hier in gut vier Jahren unter einem Dach vereint sein, dazu soll das Haus auch allen anderen Glaubensrichtungen und Nichtglaubenden offenstehen. Das Projekt soll zum Frieden unter den Religionen beitragen, Dialog und gegenseitiges Verständnis fördern und somit einen Beitrag zum Zusammenleben in der säkularen Metropole Berlin leisten – aber auch über die Stadt hinaus.
„Warum, so fragte kürzlich Joseph D'Hippolito
im ‚Wall Street Journal‘, sollte ein Christ, Jude
oder Moslem hier zum Gebet herkommen?"
Dabei entsteht das Gebäude, das nach seiner Fertigstellung von einem 42 Meter hohen Turm gekrönt sein wird, auf einem Baugrund mit hoher Symbolkraft. Die Petrikirche, die hier jahrhundertelang stand, entstand um 1230; erstmals urkundliche nachgewiesen wurde sie 1237. Sie war damit eine der ältesten Kirchen der Stadt, abgerissen wurde sie 1964 nach starken Kriegsbeschädigungen. Wie der evangelische Pfarrer Georg Hohberg der Gemeinde St. Petri – St. Marien bei einer Besichtigung des Baugrundstücks gegenüber der „Tagespost“ erläutert, war der erste Propst im 13. Jahrhundert sogar der erste Bürger Berlins – die Kirche kann damit als die Wiege der Stadt Cölln gelten, die später ein Teil Berlins wurde.
Die Fundamente des neugotischen Kirchturms sowie Reste der barocken Kirche sind noch offen sichtbar – und sie werden in den Neubau integriert werden, wie Pressesprecherin Kerstin Krupp beim Vor-Ort-Termin erläutert. Ansonsten wird der Neubau mit dem alten Glanz der Petrikirche wenig gemein haben. Er durfte architektonisch weder an eine Kirche noch an eine Synagoge oder Moschee erinnern. Herausgekommen ist ein sehr schlichter, sandfarbener Klinkerbau aus hellem Backstein. Ein zentraler Kuppelsaal, der als „Raum der Begegnung“ dienen soll, wird die drei Gotteshäuser unter einem Dach miteinander verbinden.
Ein politisch-gesellschaftliches Projekt, kein religiöses
Am Donnerstag voriger Woche, dem 27. Mai, wurde feierlich der Grundstein gelegt – unter großer Anteilnahme der Politik. 20 Millionen Euro gibt der Bund zu dem interreligiösen Bau dazu, das Land Berlin weitere zehn Millionen. Die verbleibende Finanzierungslücke wird über Spenden geschlossen – und die fließen reichlich, wie Pfarrer Gregor Hohberg betont. Aus aller Welt kämen Zuwendungen, und die stammten durchaus nicht nur von religiösen Menschen, so der Gemeindepfarrer. Damit deutet er bereits an, dass die Drei-Religionen-WG weniger ein theologisches, sondern eher ein politisch-gesellschaftliches Projekt darstellt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nahm neben Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) persönlich an der Grundsteinlegung teil – und bemühte in seiner Rede Lessings Klassiker „Nathan der Weise“, als er das Haus als „gebaute Ringparabel“ bezeichnete.
Sie gehört bekanntlich zu den Schlüsselszenen über die Frage der wahren Religion, die im ausgehenden 18. Jahrhundert den Toleranzgedanken der Aufklärung transportierten. Pfarrer Hohberg geht jedoch, wie er im Gespräch erläutert, darüber hinaus: „Die Zeit der Ringe ist vorbei“, betont er gegenüber dieser Zeitung. Wir müssten die Ringe Gott zurückgeben, sagt er – denn „die letzten Fragen liegen bei Gott“. Wir könnten uns allenfalls mit den „vorletzten Dingen“ beschäftigen, uns als Religionen gegenseitig respektieren und die Glaubensvielfalt als Stärke begreifen, ist der evangelische Pfarrer überzeugt. Dabei sei die Stiftung auch offen für andere Religionen, die hier nicht unmittelbar vertreten sind. Ziel sei es, das Zusammenleben als eine Menschheitsfamilie zu fördern und zum Gespräch einzuladen. Um Mission oder eine wie immer verstandene „Vermischung“ der Religionen geht es beim „House of One“ ausdrücklich nicht. Das erkennt auch Berlins Erzbischof Heiner Koch an. Auch wenn die katholische Kirche nicht offizieller Projektpartner ist, gehört Koch dennoch zum Kuratorium der Stiftung.
Mehrere Moscheeverbände gaben einen Korb
Wie das „WG-Leben“ in der Praxis aussehen soll, muss sich wohl nach Eröffnung des Baus noch einpendeln. Wenn – wie vor einigen Wochen – die Christen bereits in der Freude der Osterzeit stehen, die Muslime sich aber noch im Ramadan befinden, dann wird das gegenseitige Zusammenleben auch manche Spannungen aushalten müssen, gesteht auch Pfarrer Hohberg ein. Doch da sei die gegenseitige Toleranz groß, man habe Verständnis füreinander und respektiere die unterschiedlichen Fastenzeiten, ist der Geistliche überzeugt. Das gelte nicht nur für die christliche Seite, sondern auch für die jüdischen und muslimischen Partner. Hohberg ist es gelungen, die Jüdische Gemeinde Berlin und das Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg, das erste nach dem Holocaust neugegründete Rabbinerseminar in Deutschland, mit ins Boot zu holen.
Auf islamischer Seite wurde die Suche schwieriger. Mehrere Moscheeverbände gaben den Projektpartnern einen Korb, und beim größten Islamverband in Deutschland, der Ditib, stieß die Idee eines „House of One“ auf klare Zurückweisung. Der Verband ist für seine Nähe zur türkischen Regierung unter Präsident Erdogan bekannt und verlangte, bei dem Projekt exklusiv für die muslimische Seite zu sprechen – für die anderen Partner eine unannehmbare Forderung, wie Pfarrer Hohberg unterstreicht. Stattdessen holte man das „Forum Dialog“ unter Imam Kadir Sanci mit ins Boot – eine Bewegung, die dem türkischen Prediger Fethullah Gülen nahesteht – der in seinem Heimatland spätestens seit dem Putschversuch gegen Erdogan 2016 als Terrorist und Staatsfeind gilt.
Welcher Islam wird da repräsentiert?
Die Frage ist also, welche Spielart des Islam durch das Projekt überhaupt repräsentiert wird. Hier zeigt sich ein Grunddilemma des Dialogs mit dem Islam: Die großen, streng konservativen Verbände lassen sich nur schwer ins Boot holen – einer Institution, die mehrere Religionen unter einem Dach vereint, stehen sie wohl ohnehin skeptisch gegenüber. Islamverbände, die in interreligiösen Fragen aufgeschlossener sind, lassen sich durchaus finden, aber sie sprechen letztlich nur für eine Minderheit. Lässt sich so ein wirklich konstruktiver Dialog mit den Muslimen beginnen?
Im „House of One“ scheint der Wille jedenfalls vorhanden zu sein: Als in Berlin vor kurzem tausende Muslime gegen Israel demonstrierten und dabei geflissentlich verschwiegen, dass es die palästinensische Hamas war, die mit der Bombardierung Israels den Nahost-Konflikt wieder hat aufflammen lassen, veranstaltete das „House of One“ Friedensgebete, in denen die Gewalt verurteilt und eine politische Vereinnahmung der Religionen zurückgewiesen wurde. Indes: Bei vielen Muslimen in Deutschland dürfte diese Botschaft auf wenig fruchtbaren Boden stoßen, wie die Proteste in vielen deutschen Städten gezeigt haben.
Zumindest das friedliche Nebeneinander befördern
Und auch theologisch steht das Projekt auf tönernen Füßen: Warum, so fragte kürzlich Joseph D'Hippolito im „Wall Street Journal“, sollte ein Christ, Jude oder Moslem hier zum Gebet herkommen, in dieser „modernistischen“ und „sterilen“ Architektur – und überschreibt seinen Artikel mit „Berlin's New Church of Nothing“ – „Berlins neuer Kirche des Nichts“. Das sind harte Worte, aber sie treffen den Kern des Problems: Können die fundamentalen Unterschiede zwischen den Religionen wirklich durch eine Art „sakrale WG“ wegdiskutiert werden? Gewiss, es geht den Initiatoren nicht um Gleichmacherei, die dogmatischen Unterschiede sollen nicht verschwiegen werden. Gegen Dialog ist angesichts anhaltender Religionskonflikte nichts einzuwenden, er ist sogar zwingend notwendig. Doch: werden sich hier die Religionen nicht selbst säkularisieren? Sich in eine Welt einordnen, in der es keine Spannungen, keine Konflikte, sondern nur noch Dialog, Verständnis und gegenseitige Toleranz gibt?
Wer einmal als Student oder aus anderem Grund in einer WG gelebt hat, weiß genau: Das hat noch nie funktioniert. Und das muss es auch gar nicht. Denn Spannungen, auch religiöser Art, muss eine Gesellschaft aushalten. Allerdings sollten sie in der Tat friedlich gelöst werden. Wenn das Projekt einen Beitrag dazu leistet, dann sind die rund 47 Millionen Euro Baukosten nicht umsonst ausgegeben.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.