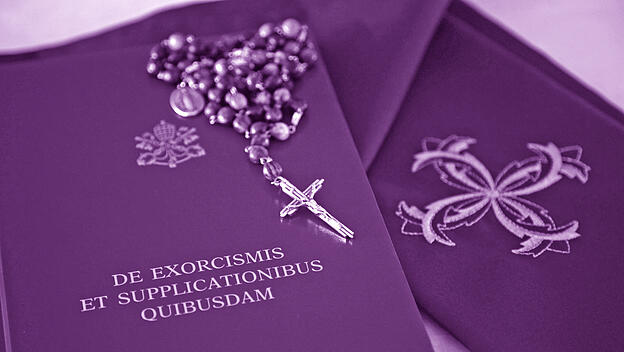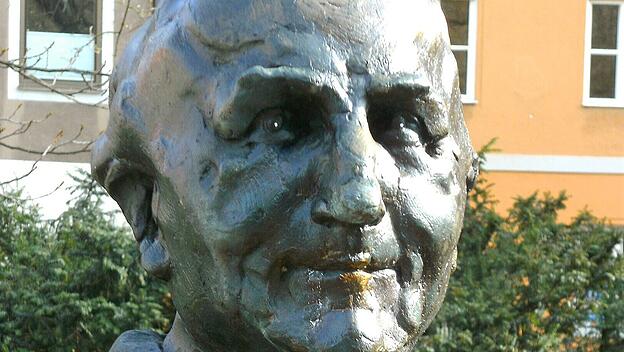Die Pop-Kultur liebte ihn schon immer. So zitierte die amerikanische Sängerin Patti Smith in ihren Songs Rimbaud und im vergangenen Jahr kaufte sie sogar das Haus in Frankreich, in dem er seine wildesten Gedichte schrieb. Auch Bob Dylan, die Doors oder Kurt Cobain und zuvor schon Benjamin Britten, Luigi Nono sowie Paul Hindemith haben die Dichtung des jungen Franzosen in ihre Musik aufgenommen, ebenso wie ein Fernand Léger in sein Werk. Dabei hatte Rimbaud gerade an der Glitzerwelt der großen Öffentlichkeit nicht das geringste Interesse. Er war eher der Nerd, der einsam und zumeist allein sein Werk schuf, sich in die Abgründe der Poesie versenkte und dabei zu ganz neuen Einsichten kam.
Arthur Rimbaud (1854–1991) war sich schon früh seines Schicksals eines Hochbegabten bewusst. Als regelmäßig bester Schüler, als der er bei Wettbewerben selbst häufig noch die Schulkameraden eine Klasse höher übertraf, war er der ganze Stolz seiner Mutter, die auf eine große Karriere ihres Sprösslings hoffte. Aufgewachsen ist er in der französischen Provinz nahe der belgischen Grenze, in Charleville an den Ufern der Maas. Weil sein Vater früh die Familie verließ, wuchs Rimbaud in katholischer Erziehung mit seiner Mutter Vitalie und den Geschwistern auf. Für das Lernen in der Schule musste er keine Zeit aufwenden, alles gelang ihm sofort; er gewann in der Schule Preis um Preis und glänzte im Verfassen lateinischer und griechischer Gedichte. Da ihm alles so leicht fiel, begann er schnell nach mehr zu suchen – es entstanden Trotz und Aufbegehren in ihm, was Rimbaud in seinem Jugendgedicht „Siebenjähriger Dichter“ andeutete: „Die Mutter schloss das Übungsbuch, Sehr stolz und schlicht/ Stand sie nun auf und ging. Oh, sie merkte nicht,/ was seine reine Stirn, sein blaues Auge sagte,/ Wie an der Kinderseele Widerwille nagte./ Am Tage, ja da ist er sehr gehorsam, klug/ Ist er; und doch, manch dunkler, sonderbarer Zug/ An ihm spricht oftmals schon von böser Heuchelei...“ Er merkt, dass er anders ist, und was in diesen wenigen Zeilen geschieht, ist typisch für die ganze spätere Dichtung von Rimbaud: Sein Werk kreist um seine eigene Person, er sieht nicht von sich ab und schafft sich so selbst als sein Werk.
Verstärkt wird dieser Gestus noch durch Georges Izambard, der, wenige Jahre älter als Rimbaud selbst, 1870 an dessen Schule kommt und sein Lehrer wird. Der belesene Izambard eröffnete Rimbaud eine neue literarische Welt, in die der Fünfzehnjährige mit dem Engelsgesicht bereitwillig eintaucht. Schon bald sehen sich die beiden auch außerhalb der Schule; Rimbaud benutzt die Wohnung des Lehrers, zu der er einen Schlüssel hat, als Zufluchtsort zum Lesen. Hier findet er auch Bücher, die seine Mutter als abgründig empfindet und vor denen sie ihn bewahren wollte. Als er einmal „Die Elenden“ von Victor Hugo mit nach Hause bringt, sieht sie sich zu einem Beschwerdebrief an Izambard gezwungen, weil „bei der Wahl von Büchern, die man Kindern in die Hände gibt, große Vorsicht geboten ist“. Izambard aber ließ sich auch nach einem Gespräch mit der Mutter nicht beirren und gab seinem Schüler, was er lesen wollte.
In diesen Monaten zeigte sich noch ein zweiter Zug Rimbauds, sein Fernweh. Als es seinem jüngeren Bruder gelang, sich als Freiwilliger 1870 zu melden, glaubte Rimbaud sich ebenfalls von zu Hause absetzen zu können und bestieg ohne Fahrkarte einen Zug nach Paris, was mit einem kurzen Gefängnisaufenthalt quittiert wurde. Izambard löste ihn mit Geld aus. Es war die erste von mehreren Fluchten und ein Vorspiel auf die Afrika-Aufenthalte Rimbauds, deren Idee er entwickelte, als er später mit dem Dichterfreund Verlaine durch die Docks von London streifte und von den Seeleuten Geschichten über ferne Länder hörte. Doch im Alter von 16 und 17 Jahren machte der junge Dichter noch seine düstersten Erfahrungen.
Rimbaud hat sich als Seher empfunden. Er sah sich den zeitgenössischen Dichtern überlegen und verachtete deren Reime. „Ich ist ein Anderer“, schrieb er im „Brief eines Sehers“ an Izambard: „Es ist falsch zu sagen: ich denke, man sollte vielmehr sagen: man denkt mich.“ Eine höhere Stimme spricht durch den Dichter, soll das heißen, auch gegen seinen Willen – Verse machen ist eben nicht Werkstattkunst, wie es noch heute oft verstanden wird – das bewusste Herstellen von Gedichten. Doch nahm Rimbaud alle verfügbaren Mittel an, um sich in eine Stimmung der Ewigkeit tragen zu lassen, mit Drogen und Alkohol, besonders aber auch mit okkulter Literatur. Das Christentum hatte er noch nicht als möglichen Weg entdeckt, doch sein innerer Kampf um Gott begann sich anzudeuten.
Zu der Suche nach der neuen Dichtung gehörte auch seine Entdeckung Baudelaires (1821–1867), über den Rimbaud schreibt: „Aber da die Schau des Unsichtbaren und das Hören des Niegehörten etwas anderes ist als die beschreibende Wiedergabe toter Dinge, ist Baudelaire der erste Seher, König der Dichter, ein wahrer Gott. Unglücklicherweise lebte er in einer zu künstlichen Umwelt, und seine so oft gepriesene literarische Form ist banal. Unbekannte Entdeckungen fordern neue literarische Formen.“ Und weiter erklärt Rimbaud: „Wenn nicht alle die alten Tröpfe an der falschen Auffassung vom Ich festgehalten hätten, so müssten wir nicht die Millionen von Skeletten hinwegfegen, die seit undenklichen Zeiten die Erzeugnisse ihres einäugigen Intellekts angehäuft haben, auf die sie auch noch stolz sind.“ Rimbaud wollte das Ich zerstören, um auf dessen Asche ein neues Leben, eine neue Welt aufzubauen. Und er gab sich vorbehaltlos dieser Suche hin, anders als Baudelaire, der sich zwar auch in Rausch und Drogen stürzte, dessen Katholizismus ihn aber dazu führte, seine Umwelt vor dem Exzess zu warnen. Rimbaud aber wollte um jeden Preis der höchste Weise werden, „le supreme savant“.
Die irische Rimbaud-Biographin Enid Starkie ist seinen dunklen Wegen gefolgt, der glaubte, die Welt lechze nach einem neuen Dichter, der der Menschheit den Weg weisen könne. So geriet Rimbaud an die Schriften von Magiern und Alchemisten, von denen er sich Befreiung für die Menschheit erhoffte sowie die inspirierende Verwirrung der Sinne. Zu den Autoren, die er las, gehörten der Historiker Jules Michelet, der die europäische Geschichte eher von Zauberern und Hexen bestimmt sah als durch die Kirche. Dazu gehörten auch der Kabbalist Éliphas Lévi, dem gemäß der Magier den „point central“ erreichen müsse, der zum „Thaumaturgen“ und damit zum Herrn der Welt befähige. Mit seiner Dichtung glaubte Rimbaud zeitweilig wirklich, auf diesem Weg zu sein, weil die Natur ihm gehorche mit dem Schaffen neuer Pflanzen, Farben und Welten. Er hoffte Christus und Satan versöhnen zu können, wovon Michelet meinte, nur die Kirche habe das bisher aufgehalten, und Rimbaud glaubte, so eine neue Weltordnung herbeiführen zu können. Ähnlich wie Picasso später sagen wird, „bei mir ist ein Bild die Summe der Zerstörung“, gab es bei Baudelaire bereits die Kunst der „Deformation“ des Wirklichen. Rimbaud hat das zur Hauptsache gemacht, so dass sich die Ordnungen verändern, „Ebene, Wüste, Horizonte zum roten Kleid der Gewitter“ werden, wo ein Julimorgen winterlichen Aschengeschmack hat oder hätten doch die Dichter nur die „Rosen, diese aufgeblasenen Rosen/ Rot auf Lorbeer-Stielen/ Und Tausende verquollene Oktaven“. Auch bei Mallarmé wird es nicht um vordergründiges Verstehen gehen, vielmehr um Sinnmöglichkeiten des Gedichts, worüber er 1896 in einem Aufsatz schrieb: „Ein Ding nennen, heißt dreiviertel des Genusses an einer Dichtung verderben; das Genießen besteht in dem allmählichen Erraten; das Ding suggerieren, hier liegt das Ziel.“ In der deutschen Dichtung werden Georg Trakl und Gottfried Benn an Rimbaud anschließen.
Die intensive Vermischung von alchemistischem Wissen und Einsichten in die Lyrik brachte Rimbaud zu dem Gedicht „Vokale“: „A schwarz E weiß I rot U grün O blau – Vokale/ Einst werd ich euren dunklen Ursprung offenbaren:/ A: schwarzer samtiger Panzer dichter Mückenschaaren/ Die über grausam Stanke schwirren, Schattenteile.// E: Helligkeit von Dämpfen und gespannten Leinen/ Speer stolzer Gletscher blanker Fürsten wehn von Dolden/ I: purpur ausgespienes Blut, Gelach der Holden/ Im Zorn und in der Trunkenheit der Peinen...“ Die Farben lösen Bilder auf und setzen sie neu zusammen – in der Alchemie galt das vollendete Werk als Schau Gottes. Und doch sind die Gedichte ein einzigartiges Dokument von Heimatlosigkeit, die für Rimbaud selbst die christliche Welt umgreift.
Größte Bedeutung für dieses Gefühl hat Rimbauds Sammlung der Gedichte „Eine Zeit in der Hölle“ (Une Saison en Enfer), in denen er seinen Kampf um Gott ausgetragen hat. Es ist wohl vor allem sein Stolz und sein jugendlicher Trotz gewesen, die ihn zur Auflehnung gegen den Glauben führten. Aber der Widerspruch steht ganz unter den Vorzeichen des Glaubens, und diesem konnte er sich nie wirklich entziehen. Gott, Glaube und das Leben hat er in diesen Gedichten behandelt. Der französische Dichter Paul Claudel schrieb dazu über Rimbaud: „Arthur Rimbaud ist kein Dichter, er ist kein Schriftsteller. Er ist ein Prophet, auf den der Geist herabgefahren ist, nicht wie auf David, sondern wie auf Saul. Derart war dieses Grauen, dieser Fluch, dem er wie Jonas durch die Lästerung und durch die Flucht zu entrinnen suchte.“ Ein Bursche von 18 Jahren bringe uns den „herzzerreißendsten Schluchzer, den die Menschheit seit den Tagen Ephraims und Judas vernommen hat, die Botschaft der paradiesischen Reinheit, inmitten einer stumpfsinnigen Welt, die sich in einem unerhörten Materialismus wälzt.“
Rimbaud war getauft und er spürte die Erbsünde in sich. In seinem Aufbäumen gegen die Liebe Gottes erkennt er seine Schwäche: „Die Haut meines Kopfes schrumpft. Erbarmen! Herr, ich habe Angst. Mich dürstet, mich dürstet so! Oh! die Kindheit, das Gras, der Regen, der See über den Kieselsteinen, Mondschein, wenn die Glocke zwölf schlug ... Der Teufel sitzt im Glockenturm, zu dieser Stunde. Maria! Heilige Jungfrau! ... Schrecklich, meine Dummheit!“
Rimbaud sieht sich für alle seine Laster in anderen Höllen, für den Zorn, den Hochmut, die Faulheit und bekommt Angst, die Ewigkeit für immer zu verlieren, wenn er weiter an seinem Trotz festhält. Am Ende der „Zeit in der Hölle“ gewinnt er Hoffnung und sieht einen neuen Morgen, und so heißt auch ein Gedicht, „Morgen“: „Wann werde ich, über alle Gestade und Berge hinweg, die Geburt der neuen Arbeit grüßen, die neue Weisheit, die Flucht der Tyrannen und Dämonen, das Ende des Aberglaubens und anbeten – als erster! – Weihnachten auf Erden?“ Rimbaud hoffte auf die universale Liebe, die im Unterschied zur Fortschrittsidee der Industrialisierung zu einem Fortschritt in Teilnahme und Mitleiden mit den Menschen führen sollte.
Und doch wollte er Europa, dem Abendland den Rücken zuwenden. Ganz neu beginnen bei den Urvölkern Afrikas, wo er das ursprüngliche Leben vermutete, wie er auch zuvor die Ursprünge der Dichtung suchte. Zuwider war ihm seine Vergangenheit, nach der gescheiterten Hoffnung, in Paris ein Dichterleben verwirklichen zu können. Der ständig verarmte Rimbaud war in seiner zerschlissenen Kleidung der Pariser Gesellschaft schnell als Strolch erschienen, und er tat nichts, um diesen Eindruck zu zerstreuen. Dass er bei einer Dichterlesung nach jedem Vers „merde“ dazwischenrief, führte zum Hausverbot – er wurde zum Ausgegrenzten, der sich aber dichterisch überlegen fühlte und das seine Mitwelt spüren ließ. Der späte Ekel nach der Verführung durch Verlaine und ihre beiden Reisen nach London machten Rimbaud den Abschied noch leichter.
Mit 19 Jahren beendete Rimbaud sein Dichtertum und begann sein Leben als Wanderer zwischen den Welten. Er besuchte Kairo, Alexandrien, Java und versuchte sein Glück als Händler in Äthiopien, Abessinien und im Jemen. Zwischendurch versuchte er auf seinen Reisen Dachdecker, Maurer, Schmied oder Glasbläser zu werden, ließ sich Bücher von zu Hause schicken, um sich einzuarbeiten, aber er scheiterte wie auch als Händler, weil er einfach nicht die nötige Erfahrung und das Verhandlungsgeschick hatte. Dafür wurde aber jetzt, in der wirklichen Welt jenseits der Dichtung, ein ganz neuer Zug an Rimbaud deutlich. Er war der, von dem er in seinen Dichtungen häufig geschrieben hatte, der mitleidsvolle, großzügige Mensch. In den afrikanischen Regionen, in denen er sich aufhielt, war er weithin bekannt als der, der Armen sein Geld verschenkte und der sich Bittenden gegenüber so erweichen ließ, dass er kaum genug für sich selbst hatte und es nie annähernd zu dem Auskommen brachte, das er sich immer erwünscht hatte. Und so musste er hart arbeiten, häufig auch unter großer Gefahr seines eigenen Lebens, als er etwa wochenlang mit einer Kamelkarawane durch Wüstengebiete ritt, weil er mit einem Stammeshäuptling Geschäfte machen wollte, der dann aber schon wieder drei Tagesreisen entfernt war, als Rimbaud an seinem Ziel ankam. „Ich tue Gutes“, sagte er einmal in Harar in Äthiopien, „wenn sich die Möglichkeit dazu bietet, es ist in der Tat mein einziges Vergnügen.“
Rimbaud wurde krank. Anfangs tat nur das Knie weh, dann das Bein mit unerträglichen Schmerzen. Er musste Afrika verlassen, reiste nach Marseille, wo das Bein im Krankenhaus zur Unbefleckten Empfängnis amputiert wurde. Er wurde nicht mehr gesund und fuhr qualvoll nach Hause, bis er zu der Überzeugung kam, nur die Wärme Afrikas könne ihn heilen. Also reiste er mit seiner Schwester Isabelle wieder Richtung Süden, kam aber nur bis Marseille in dasselbe Krankenhaus. Sie betete viel mit ihm und nach der Absolution sagte ihr der Pfarrer, die draußen gewartet hatte: „Was hast Du mir gesagt, Kind? Dein Bruder glaube nicht? Ich habe selten einen Glauben gesehen, der so stark war wie seiner.“ Immer wieder fragte Rimbaud seine Schwester, ob sie glaube, und sie sagte ja, man müsse glauben. Er: „Dann muss das Zimmer hergerichtet werden. Der Priester kommt mit dem Sakrament zurück. Du wirst sehen, wie es sein wird. Sie bringen Kerzen mit und schöne Spitzen. Weiße Decken gehören noch überall hin. Bin ich denn so krank?“ Diese Bekehrung ist die endgültige Aufgabe seines Stolzes gewesen. In seinen letzten Tagen soll die Härte von ihm abgefallen sein und sein Gesicht den Ausdruck der Vergeistigung angenommen haben.
Am 10. November 1891 ist Rimbaud gestorben. Die Briefe aus Paris, die die begeisterten Entdecker seines Werkes in seinen letzten Monaten an ihn geschrieben hatten, um ihn als den großen Dichter der Gegenwart zu feiern, hatte er nicht mehr beantworten wollen. Zu fern war ihm das Dichten geworden, zu nah seine Hoffnung, aus der „neuen Liebe, eben der Caritas, einen neuen Lebenswillen zu schöpfen“, wie sein Biograf Yves Bonnefoy den Kampf Rimbauds gegen das Elend des Lebens beschreibt.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.