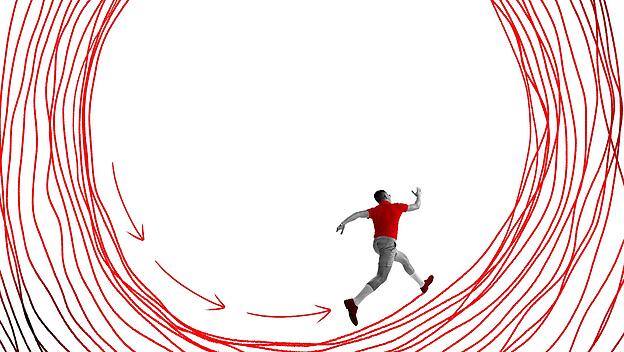Frau Schuller-Munteanu, das Bundesministerium für Gesundheit hat Ende letzten Jahres einen Entwurf für ein Hochschulstudium der Psychotherapie vorgelegt, das mit Approbation und Staatsexamen schließt und für gutachterliche Tätigkeiten und teilweise zur Verschreibung von Psychopharmaka ermächtigen soll. Die Pflicht zur somatischen Abklärung psychischer Störungen soll ersatzlos gestrichen werden. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Psychiatrie und Nervenheilkunde spricht von der Gefährdung der Patientensicherheit und von einer Abspaltung von psychisch erkrankten Menschen aus dem medizinischen System. Wie bewerten Sie diese Debatte?
Alles Bemühen im Gesundheitswesen muss auf die beste Behandlung der Patientinnen und Patienten ausgerichtet sein. Ein offener Geist für Neuerungen ist daher erforderlich, insbesondere bei psychischen Erkrankungen. Insgesamt ist das ein sehr interessanter Arbeitsentwurf. Im anglo-amerikanischen Raum gibt es schon seit Jahren Bemühungen, Verschreibungen auch von Nicht-Ärzten vornehmen zu lassen. Das sind überwiegend Kräfte aus dem Pflegebereich mit einem entsprechenden Hochschul- und einem Aufbaustudium, bestehend aus etwa 1200 Stunden Praktika im medizinischen Bereich.
Zu bedenken ist jedoch: Fachärztinnen und -ärzte für Psychiatrie behandeln Menschen die oft mehrfach schwer erkrankt sind. Unsere Patientinnen und Patienten leiden oft zusätzlich an Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, dementiellen Syndromen oder auch Epilepsien. Auch die Behandlung von Kindern und Jugendlichen und Menschen mit Behinderungen gehört zu den Aufgaben der Psychiatrie. Eine organische Abklärung und Überprüfung wie sich die Psychopharmaka auf die anderen Erkrankungen und Medikamente auswirken ist unverzichtbar. Die Patientensicherheit ist hier eine absolute Priorität. Ohne eine qualifizierte medizinische Ausbildung wie die Facharztausbildung kann dies nicht geleistet werden.
Kann die Reform eine neue Konkurrenzsituation für Ärzte bedeuten?
Von einer Konkurrenzsituation zwischen den Ärzten und psychologischen Psychotherapeuten möchte ich nicht sprechen. Sicher gibt es Vorbehalte wie das Ganze praktisch umgesetzt werden soll: Wie lange wird das Studium tatsächlich dauern? Welche Praktika müssen dazukommen um die medizinische Sicherheit der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten? Wie sollen die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen an die notwendigen Ressourcen, kommen um die Medikamente sicher zu verschreiben? Hierzu sind verschiedene Untersuchungen notwendig. Wer schafft die EKG- Geräte an und wertet die EKG aus? Wer wird die Laborwerte bestimmen? Wie werden die cerebralen Bildgebungen durchgeführt? Sind dies Aufgaben, die auf die zukünftigen psychologischen Psychotherapeuten zukommen? Lauter Fragen, die der Gesetzentwurf noch nicht beantwortet. Ich habe aber den Eindruck, dass der Entwurf darauf zielt, die Situation psychisch Erkrankter in Deutschland zu verbessern und ihnen eine schnellere und adäquate Behandlung zu ermöglichen.
Wenn sich die Reform durchsetzt, müssten Studienanfänger im ersten Semester entscheiden, ob sie sich den Beruf des psychologischen Psychotherapeuten zutrauen. Wie stellt man fest, ob man geeignet ist und welche Schnittmengen es zum Psychiaterberuf gibt?
Aktuell beinhaltet die Ausbildung zum Psychotherapeuten nach dem Psychologiestudium neben den Praktika im Studium ein praktisches Jahr im Krankenhaus. Diese Praktika und theoretischen Vermittlungen von Lerninhalten bieten eine ausreichende Grundlage um festzustellen, ob man für den Beruf geeignet ist. Auch kann man während der praktischen Ausbildungszeit durchaus einen Eindruck davon gewinnen, ob er einen im späteren Berufsleben erfüllen wird und man ihn gut erfüllen kann. Schnittmengen gibt es auf jeden Fall, auch wenn der Weg ein anderer ist.
Eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie absolviert erst ein reguläres Medizinstudium – sieben Jahre, davon ein Jahr rein praktische Tätigkeit im Krankenhaus – dann noch einmal vier Jahre Ausbildung in Psychiatrie und ein Jahr neurologische Ausbildung. Zusätzlich erlernt er oder sie ein Psychotherapieverfahren. Das ist vom Ansatz her ein ganz anderer Weg als ein Psychologiestudium mit anschließender Therapieausbildung. Voraussetzungen für die Behandlung psychisch erkrankter Menschen sind sicherlich eine ausreichende persönliche Reife, eigene psychische Stabilität und die Fähigkeit zum Umgang mit Leid.
Gemeinsam ist beiden Berufsgruppen ein generelles Interesse daran, Menschen in psychischen Extremsituationen und mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Wir haben die gemeinsame Schnittmenge der Naturwissenschaften als Grundlagen unserer Studiengänge und den gemeinsamen Weg des Psychotherapieverfahrens. Das heißt: Unser Hintergrund ist verschieden, aber wir treffen uns auf der Nadelspitze der Behandlung psychischer Erkrankungen. Eine offene, wertschätzende Grundhaltung und ein allgemeines naturwissenschaftliches Grundverständnis verbunden mit Empathie ist sicherlich beiden Berufsgruppen gemein.
Wie gehen PJ-ler mit Grenzerfahrungen im Beruf um? Gibt es Abbrecher?
Die Abbrecherquote ist praktisch gleich Null. Natürlich sage ich gerne, dass dies auch den exzellenten Bedingungen in unserer Klink zu verdanken ist. Hinweisen muss ich aber darauf, dass das Einsätze sind, die klassischerweise zum Ende der Ausbildung erfolgen. Die LVR-Klinik in Bonn hat ein sehr gutes Einarbeitungskonzept für Mitarbeiter: Alle durchlaufen ein Training, um deeskalierende Techniken und Abläufe kennenzulernen. Bei allen Grenzsituationen in denen es um Gewalt geht, gibt es immer eine reguläre Nachbesprechung auf den Stationen. Am Ende ihrer Ausbildung und am Anfang ihrer Berufstätigkeit werden die jungen Menschen von den Teams durchgehend betreut. Jeder hat einen Ansprechpartner, einen Supervisor. Die Verantwortung liegt nicht allein bei dem Auszubildenden. Der Druck verteilt sich auf das gesamte Team und wird auch im Team gelöst. In besonders belastende Situationen bieten wir auch eine Sonder-Supervision an. Die Medizinstudierenden nehmen an den ärztlichen Fortbildungen und Supervisionen teil, die Psychologiestudierenden im praktischen Jahr haben ebenfalls die Gelegenheit zu einer Supervision in der Gruppe. Sie werden zusätzlich klinisch durch die Oberärztinnen und -ärzte auf den Stationen supervisiert. Eine regelmäßige Supervision ist absolut notwendig, um die Qualität der Behandlung und die körperliche und seelische Unversehrtheit der Mitarbeitenden zu sichern. Die Studierenden im praktischen Jahr bringen aber natürlich schon prinzipiell Interesse an dem Wahlfach Psychiatrie mit. Wer einmal erlebt hat, wie gut man Menschen mit einer psychischen Erkrankung helfen kann und wieviel Freude die Arbeit in einem therapeutischen Team macht, ergreift dann auch oft den Beruf der Psychiaterin bzw. des Psychiaters.
In einer Stellungnahme der DGPPN, heißt es, die in früheren Jahren vorherrschende Religionskritik und auch Pathologisierung von Religiosität ist nicht mehr angemessen; die kritische Haltung sollte aber auch nicht undifferenziert durch eine Idealisierung dieses Feldes ersetzt werden. Ist ein religiöser Bezug ein Vorteil, wenn Religion im therapeutischen Kontext wieder verstärkt berücksichtigt werden kann?
Spiritualität, egal welcher Konfession oder Religion, kann eine Ressource sein. Das erleben wir sowohl bei Katholiken, als auch bei Evangelischen und Muslimen bis hin zu den freien spirituellen Glaubensformen. Spiritualität kann in einer psychischen Krise einen starken Halt geben. Mit dieser Ressource kann und muss man arbeiten. Als Beispiel: Ich habe ein Gefühl, dass etwas Gutes in mir ist, dass nicht vergehen kann. Oder: Ich hoffe darauf, dass sich das Leben verbessert oder dass es Werte gibt, die mich überdauern. Das kann man sehr gut als Kraftquelle sowohl im psychotherapeutischen Kontext als auch im therapeutischen Kontext allgemein nutzen.
Psychiater wie Wolfgang Schneider von der Uni Rostock bemängeln eine zunehmende Pathologisierung normaler Belastungs- und Trauerreaktionen. Demgegenüber begründet der Berliner Psychiater Michael Linden die steigende Zahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen, dass psychische Erkrankungen nicht zunehmen, aber heute besser erkannt würden als früher. Wie sehen Sie das?
Beide Blickwinkel haben ihre Berechtigung. Sicher gibt es in der heutigen Gesellschaft einen hohen Druck, perfekt zu funktionieren. Dieser Leistungsdruck kann daran hindern, Reaktionen für die wir früher vielleicht mehr Zeit und Freiheit hatten, zum Beispiel Trauer, richtig zu erleben und auszuleben. Für solche Reaktionen gab es früher mehr Toleranz in der Gesellschaft. Dahingehend kann ich die Äußerung in Bezug auf die Pathologisierung normaler Reaktionen durchaus nachvollziehen, jedoch nicht mittragen. Jeder hat ein eigenes Spektrum an emotionaler Betroffenheit und Leistungsfähigkeit, das sehr unterschiedlich sein kann. Dafür muss den Menschen auch genügend Zeit und Raum gegeben werden – insbesondere für Dinge wie Trauma-Verarbeitung und Trauer.
Das andere ist ein Trend, den ich eher begrüße: Nach meinen Beobachtungen werden psychische Erkrankungen durch die verbesserte Annahme dieser Erkrankungen durch die Gesellschaft auch früher diagnostiziert. Ich begrüße das deshalb, weil die Behandlungsmöglichkeiten sehr gut sind. Psychische Erkrankungen können sowohl die Lebensqualität als auch die Lebenszeit der Betroffenen mindern. Das bedeutet auch: Je früher die Erkrankungen erkannt und behandelt werden, umso besser ist der Einfluss auf die Lebensqualität für den Betroffenen. Die Hilfsmöglichkeiten sind andererseits sehr gut. Von Pathologisierung kann hier nicht die Rede sein.
Wie hoch schätzen Sie vor diesem Hintergrund das Risiko ein, dass beispielsweise unter den Stichwörtern posttraumatische Belastungsstörung oder Depression aus Menschen mit Problemen Patienten gemacht werden?
Das entspricht nicht meinen Alltagserfahrungen in einer psychiatrischen Klinik. Ich mache eher die Erfahrung, dass die Menschen sich zu spät in Behandlung begeben. Oft werden die entsprechenden Diagnosen zu spät gestellt, weil es immer noch ein Schamgefühl gibt. Mir ist auch nicht bekannt, dass es zu einer Häufung von Fehldiagnosen gekommen sei. Es gibt sehr klar ausgelegte Diagnosekriterien sowohl für die posttraumatische Belastungsstörung als auch für die Depression.
Am Beispiel der Posttraumatischen Belastungsstörung: Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ein Trauma unter bestimmten Voraussetzungen nach der zunächst auftretenden psychischen Belastung langfristig keine weiteren Beeinträchtigungen hinterlässt. Menschen können durch die eigenen psychischen Kräfte und mit ausreichend Zeit ein Trauma verarbeiten. Erst wenn Symptome wie Ängste, Albträume oder sich ausdrängende Erinnerungen nach vier Wochen noch fortbestehen kann man von einem Krankheitswert sprechen. Diese Zeit muss den Betroffenen auch gegeben werden.
Trotz klarer Diagnosekriterien stehen aber auch Kliniken unter dem Druck der Wirtschaftlichkeit.
Da stimme ich Ihnen zu. Das ist aber aus meiner Erfahrung in diesem Zusammenhang keine Belastung. Bei Krankheiten wie Depressionen sind nicht alle Schweregrade per definitionem stationär behandlungsbedürftig. Bei leichter bis mittelgradiger Depression kann den Menschen auch in ambulanter oder teilstationärer Therapie geholfen werden.
Inzwischen wird über den Wegfall des Fernbehandlungsverbotes diskutiert. Lassen sich dadurch mehr psychisch kranke Menschen erreichen? Wie sehen Sie das?
Innovationen sollte sich die Medizin nie verschließen. Die Patientensicherheit darf dadurch aber nicht gefährdet werden. Therapieformen im Sinne von Online-Therapien werden aktuell noch erprobt. Nach meinem Kenntnisstand gibt es aber noch keine groß angelegten Studien die zeigen, ob ein gleich guter Therapieerfolg zu erzielen ist, oder ob die Ergebnisse schlechter ausfallen. Prinzipiell kann sicherlich nichts das therapeutische Gespräch von Mensch zu Mensch ersetzen – weder generell in der Medizin noch insbesondere in der Psychotherapie. Der Einsatz bestimmter Therapiemodule als eine gute Ergänzung zu einer primären Behandlung und Nutzung von Online-Tools wird sich in Zukunft weiterentwickeln. Das ist der Ansatz der "Blendet Care", d.h., persönliche Gespräche werden durch Online Kontakte zusätzlich ergänzt. Für die junge online-affine Generation wird dieses Instrument sicher mehr an Bedeutung gewinnen.
Stichwort Medien: Nach der Wahl von Donald Trump haben verschiedene Psychiater Aussagen über seinen Geisteszustand gemacht. Was halten Sie von solchen Ferndiagnosen? Werden Psychiater in Zukunft verstärkt in der Öffentlichkeit stehen?
Mir ist aufgefallen, dass in den verschiedenen Meldungen dazu das Wort Diagnose sorgfältig vermieden worden ist. Es gab einen lebhaften Austausch zwischen verschiedenen Zusammenschlüssen amerikanischer Psychiater. Die American Psychiatric Association hat ihre Richtlinien, nach denen sich Ärzte und Psychotherapeuten zu einzelnen Personen oder Erkrankungen äußern sollten, eher nochmals verschärft. Die Berufsvereinigung der amerikanischen Psychoanalytiker befürwortete einen eher liberaleren Umgang mit Informationen. In unserer Öffentlichkeit geht man medial anders um mit Persönlichkeitsrechten und medizinischen Fragen als im anglo-amerikanischen Raum.
In Deutschland kann man mit gutem Gewissen sagen, dass der größte Teil der Medien sehr respektvoll mit den einzelnen Personen umgeht. Das zeigt sich auch darin, wie Ärzte Verdachtsdiagnosen oder medizinischen Spekulationen handhaben. Wenn Psychiaterinnen und Psychiater öffentlich auftreten, wird das meiner Meinung nach hauptsächlich dafür genutzt, das Stigma der psychiatrischen Erkrankungen möglichst abzubauen. Oft wird für einen empathischen und wertschätzenden Umgang mit und für Menschen geworben, die an psychiatrischen Erkrankungen leiden. Ein anklagender Kontext gegen eine öffentliche Person mit Spekulation darüber, ob diese an einer psychischen Erkrankung leidet, würde sicherlich von der Gesellschaft in Deutschland anders beantwortet, als das in Amerika der Fall ist.
Zumindest der anklagende Umgang mit einer psychiatrischen Erkrankung ist bei einer Medienfigur kritisch zu werten.
Gehen Sie vor dem Hintergrund einer zunehmenden Liberalisierung der Gesetzgebung in Europa zum assistierten Suizid davon aus, dass der Gesetzgeber in Deutschland nachzieht? Können junge Menschen, die Sterbehilfe kritisch sehen, trotzdem noch guten Gewissens den Beruf des Psychiaters ergreifen, auch mit Blick auf die Zukunft?
Keine Ärztin und kein Arzt werden jemals dazu gedrängt oder gezwungen werden können, am Suizid eines Patienten mitzuwirken. Dies gilt auch für den assistierten Suizid. Da kann ich jeder jungen Kollegin und jedem jungen Kollegen versichern, dass sie oder er nicht befürchten muss, in einen ernsthaften Gewissenskonflikt zu geraten. Im aktuellen Kontext muss sich jede Ärztin und jeder Arzt primär dem Genfer Gelöbnis verpflichtet fühlen. Zusätzlich selbstverständlich auch dem Gesetzeswerk, das unseren Alltag bestimmt und den medizinischen Werten und Normen, die durch die Leitlinien unser medizinisches Handeln gestalten. Das Genfer Gelöbnis beruht auf der alten Historie des Hippokratischen Eides und wird immer wieder kritisch beleuchtet und aktualisiert - zuletzt im Oktober 2017. Da wurde noch ein Passus aufgenommen, der festsetzt, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderen Faktoren nicht zwischen die ärztliche Pflicht und die Patientin bzw. die Patienten treten dürfen. Wer plant, den Beruf der Psychiaterin bzw. des Psychiaters zu ergreifen, muss ethische Entscheidungen nicht alleine tragen. Zwar muss man selbst seine eigenen ethischen Werte und Normen immer wieder überprüfen, aber Behandlungsentscheidungen werden immer auch im Team gefällt. Und wenn es schwierige Situationen gibt, hat jedes Krankenhaus Zugang zu einer Ethikkommission oder ethischen Fallbesprechung.
Wie sieht das bei Ihnen konkret aus?
Wir in der LVR-Klinik Bonn führen seit jeher ethische Fallbesprechungen durch, um schwierige Fälle vorstellen können. Daran nimmt neben der Ärzteschaft auch der Pflegedienst teil, der Sozialdienst und die Geistlichen der verschiedenen Konfessionen. Der Fall wird neutral besprochen und von allen Seiten nochmal beleuchtet. Der von Ihnen angedeutete einsame ethische Gewissenskonflikt wird von niemandem allein ausgetragen. Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich während des gesamten Studiums und in meiner beruflichen Laufbahn noch nie zu einer Entscheidung bezüglich meiner medizinischen Verpflichtung meinen Patientinnen und Patienten gegenüber gedrängt wurde, die mir ethisch zuwidergelaufen wäre.
Gibt es auch in der Psychiatrie eine Kommerzialisierungstendenz, so dass verstärkt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten entschieden und Druck auf Behandlungsentscheidungen ausgeübt wird? Könnte das auch die Debatte um den assistierten Suizid verschärfen?
Die erste Frage kann ich aus meiner persönlichen Berufserfahrung nicht ganz verneinen. Das Gesundheitssystem bewegt sich sicherlich in einem Spannungsfeld: Wir wünschen uns als Ärztin oder Arzt für unsere Patientinnen und Patienten die optimale Behandlung. Während man diese Behandlung für den Patienten entwickelt, spielt der Kostenfaktor keine Rolle. Die Überwachung der Kosten übernehmen andere Instanzen im Krankenhaus - damit wird die rein medizinische Behandlung in keiner Weise belastet. Dass die Kosten überwacht werden müssen, beruht auf unserer Verpflichtung den Beitragszahlern gegenüber. Diese finanzieren in unserem Gesundheitssystem monatlich die Behandlungen für alle. In unserem sozialen Gesetzbuch ist festgelegt, dass die Behandlung „das Maß des Notwendigen nicht überschreiten darf“. Natürlich würden wir als Mediziner immer sagen, notwendig ist eine optimale Behandlung. Dass die verschiedenen Kostenträger diese nicht zahlen wollen, passt nicht zu meinem Eindruck aus dem klinischen Alltag. Finanzielle Beweggründe werden nicht in die direkten Behandlungsüberlegungen mit einbezogen. Das primäre Behandlungsteam muss von diesem Druck frei sein, insbesondere die jungen Kolleginnen und Kollegen.
Diese Trennung zwischen den finanziellen Überlegungen und den Mitarbeitenden, die konkret Patientinnen und Patienten behandeln, ist auch in anderer Hinsicht wichtig: In den Zeiten des Fachkräftemangels müssen Ärztinnen und Ärzte primär mit der reinen Behandlung beschäftigt sind.
Beachten Sie auch die Bildungsseite in der aktuellen Tagespost-Ausgabe vom 12. Juli 2018.
DT (jbj)